Zwischen Unterstützung und Stigmatisierung: Sozialarbeit an Wiener Mittelschulen
In der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen stellen Schule und Familie in der Regel die zentralen Sozialisationsinstanzen dar. Wenn in einem dieser Systeme Spannungen, Überforderungen oder strukturelle Defizite auftreten, kommt Schulsozialarbeit ins Spiel – oft in enger Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe. Die Tendenz ist steigend. Es gibt einige Schulen, die beinahe wöchentlich Gefährdungsmeldungen machen (müssen), weil das Kindswohl gefährdet, die Entwicklung nicht adäquat unterstützt und/oder die Lebensumstände zuhause prekär sind.
Schulsozialarbeit: Prävention, Intervention und Beziehung
Schulsozialarbeit verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen, sozialen und schulischen Entwicklung zu fördern. Sie arbeitet systemisch, vertraulich und freiwillig – und doch sehen sich viele Familien mit Misstrauen konfrontiert, sobald der Begriff „Sozialarbeit“ fällt. Zu groß ist die Sorge, in eine Schublade gesteckt oder gar pathologisiert zu werden – viele Eltern sind des Weiteren der Ansicht, „das Jugendamt nehme ihnen die Kinder weg!“.
Die Aufgabe der Schulsozialarbeit ist es zu vermitteln, zu begleiten und Brücken zu bauen– zwischen Schule und Elternhaus, zwischen pädagogischem Anspruch und sozialer Realität. Im Wiener Kontext bedeutet das oft, mit Eltern zu kommunizieren, deren Vertrauen in staatliche Institutionen historisch oder biografisch beschädigt ist – sei es aufgrund von Fluchterfahrungen, Armut, Rassismus oder generell fehlender Teilhabe.
Das Jugendamt: Partner oder Bedrohung?
In der öffentlichen Wahrnehmung ist das ehem. Jugendamt, heute Kinder- und Jugendhilfe Wien, vielfach mit einer gewissen Ambivalenz behaftet. Während es in seiner Aufgabe als Kinderschutzinstanz agiert und wichtige Unterstützungsleistungen bietet – von Familienbegleitung über Kriseninterventionen bis hin zu Fremdunterbringungen –, wird es von vielen Eltern primär als Kontrollinstanz erlebt. Gerade wenn Schule eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt initiiert, fühlen sich Erziehungsberechtigte häufig übergangen oder in ihrer Kompetenz infrage gestellt.
Diese Spannung kann nur durch transparente Kommunikation, niederschwellige Kontaktangebote und eine sensible, kulturbewusste Haltung aufgelöst werden. Schulsozialarbeiter:innen sind hier entscheidend: Sie können Übersetzer:innen zwischen Lebenswelten sein, Ängste abbauen und helfen, das Jugendamt nicht als Gegner, sondern als Ressource zu begreifen und hiermit eben auch Lehrkräfte unterstützen, die mit ihren pluralen Aufgaben oft an die Grenzen des menschlich Machbaren stoßen.
Ganztagsschule: Chance und Herausforderung zugleich
Ganztägige Schulformen bieten grundsätzlich einen fruchtbaren Boden für nachhaltige sozialpädagogische Arbeit. Die erweiterte Verweildauer der Kinder in der Schule schafft Zeiträume für Beziehungsaufbau, kreative Angebote, sozial-emotionale Lernfelder und intensive Begleitung. Zugleich zeigen sich in Ganztagsschulen jedoch auch strukturelle Spannungen: Das pädagogische Personal steht oft unter hohem Druck, multiprofessionelle Teams arbeiten nicht immer reibungslos zusammen, und Eltern fühlen sich – besonders in sozial belastenden Situationen – häufig von Entscheidungen überrollt und/oder ausgeschlossen. Im schlimmsten Fall möchten Eltern schon nicht mehr mit der Schule kooperieren. „Das/ Der/ Die ist jetzt eure Aufgabe – ich möchte keine Beschwerden/Nachrichten mehr von Ihnen erhalten!“
Hier kann eine enge Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, Schulsozialarbeit und Schulteam helfen, systemische Lösungen zu entwickeln: etwa durch gemeinsame Fallbesprechungen, Intervisionsformate oder die Entwicklung von Unterstützungskonzepten für Schüler:innen mit komplexen Problemlagen. Das Schulkooperationsteam ist hier ein erster Ansprechpartner.
Elternarbeit: Beziehung statt Belehrung
Elternarbeit ist der Schlüssel zur Wirksamkeit schulsozialer Maßnahmen. Doch gerade in Zeiten, in denen denen Jugendliche und Kinder vermehrt mit psychischen Problemen und Unwohlsein zu kämpfen haben, ist diese Arbeit nicht trivial. Sprachliche Hürden, Scham, Erschöpfung oder lebensweltliche Differenzen erschweren den Dialog. Schulsozialarbeiter:innen müssen sich hier als Ermöglichende begreifen – nicht als Instanzen der Bewertung. Aufsuchende Formate, Elterntreffs in vertraulicher Atmosphäre, die Zusammenarbeit mit Community-Leader:innen und/oder Dolmetschdiensten können hier wirksame Mittel sein.
Ziel muss es sein, Eltern in ihrer Rolle zu stärken, statt sie zu korrigieren – und gleichzeitig das Wohl des Kindes im Blick zu behalten. Es gilt, Vertrauen nicht nur einzufordern, sondern aktiv herzustellen. Der Kinder- und Jugendhilfe ist es ein Anliegen ist, mit den Familien gut zu kooperieren – und dabei immer im Sinne des Kinderschutzes gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden.
Fazit: Eine gemeinsame Verantwortung
Die Herausforderungen, vor denen Wiener Mittelschulen stehen, sind strukturell, sozial und komplex. Niemand kann diesen komplexen Aufgaben allein begegnen. Was es braucht, ist ein echtes Zusammenspiel – auf Augenhöhe mit den Familien, mit offenen Kommunikationswegen, ausreichend Ressourcen und einer klaren gemeinsamen Vision: Alle Kinder verdienen die bestmögliche Unterstützung, unabhängig von Herkunft, Sprache oder sozialem Status.
Die Schule kann dabei ein Ort sein, an dem Bildung und Sozialarbeit nicht nebeneinander, sondern miteinander wirken – im Dienst der nächsten Generation.
D
Franziska Haberler, Lehrerin an einer Wiener Mittelschule – in Co-Autorenschaft mit Ingrid Pöschmann, Öffentlichkeitsarbeit der MA 11.


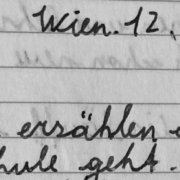








Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!