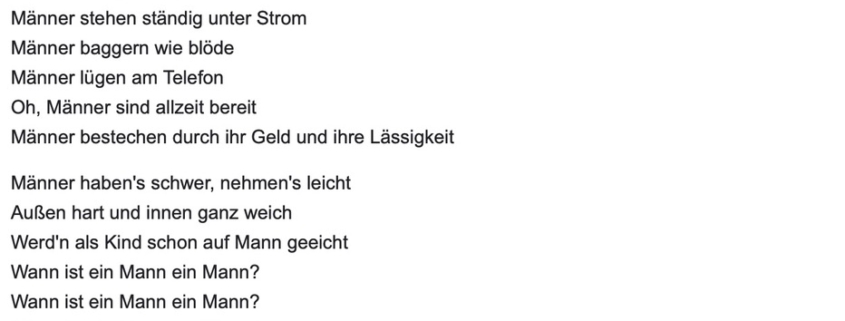Männlichkeiten und toxische Männlichkeit. Ein geschlechterreflektierender Aufruf
Zurück aus den Sommerferien und mitten in der Planung der Themenschwerpunkte fürs neue Schuljahr erinnerte ich mich einer schulinternen Auseinandersetzung letzten Juni. Streitpunkt war eine Formulierung für den alljährlichen Schullauf. Auf einem Plakat für den alljährlichen Schullauf stand: „Mädchenrunde“ 5km und „Jungsrunde“ 10km. Einige Kolleg*innen und ich äußerten unser Unverständnis zu dieser Formulierung. Uns störte die geschlechtergetrennte Einteilung der Strecken und der tradierten Vorstellung, Jungs seien sportlicher/leistungsstärker als Mädchen. Zudem reproduzierte es die Annahme der Zweigeschlechtlichkeit. Darüber hinaus schreibt es eine nach Geschlechtern getrennten Welt sowie die Zuweisung in „weibliche“ und „männliche“ Sphären (Fußball vs. Frauenfußball) weiter fort.
Nebenbei könnten sich einige Schüler*innen ausgebremst und andere entmutigt fühlen. Bestimmt gibt es Schülerinnen, die gerne 10km laufen möchten, aber Angst haben, als „unweiblich“ beschämt oder ausgegrenzt zu werden. Und genauso gibt es bestimmt Schüler, die gerne nur 5km laufen möchten, aber ebenso die Sorge haben könnten, mit dem Etikett „unmännlich“ versehen zu werden. Warum diese Sorge gerade unter Jugendlichen, aber auch unter erwachsenen Männern ein großes Problem darstellt, möchte ich in weiterer Folge näher erläutern. Ziel dieses Textes ist es, Lehrer*innen einen kleinen Einblick in die sozialwissenschaftliche Diskussion rund um (hegemoniale) Männlichkeit, toxische Männlichkeit und die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit denselben für den feministischen Kampf zu geben.
Zudem ist die Pubertät eine intensive Phase der Identitätsarbeit und -findung. Wir alle sehen uns innerhalb der Gesellschaft mit normativen Vorstellungen von „Frausein“ und „Mannsein“ konfrontiert und müssen uns tagtäglichen gegenüber diesem Erwartungsdruck auf die ein oder andere Weise positionieren. Während erfreulicherweise immer häufiger und selbstverständlicher traditionelle Frauenrollen und -bilder thematisiert werden, findet die Auseinandersetzung mit (toxischer) „Männlichkeit“ seltener Eingang in den Unterricht. Zwar erfahre ich im privaten wie im schulischen Bereich von Freunden und Kollegen Zustimmung bei feministischen Kämpfen, jedoch werden eigene desktruktive Verhaltensweisen wie Dominanz, Erniedrigung, Hyperkonkurrenz und Kontrolle seltener reflektiert. Der Text möchte daher zur Selbstreflexion motivieren sowie den Mut fördern, „Männlichkeit“ und toxische Männlichkeit im Unterricht zu behandeln. Schlussendlich möchte der Text einen kleinen Teil zum feministischen Kampf für mehr Selbstbestimmung und den Abbau von Hierarchien und Ungleichheiten (vor allem im Schulalltag) beitragen.
Definition von Männlichkeit
Allgemein wird unter dem Terminus „Männlichkeit“ positive und negative Verhaltensweisen und Praktiken verstanden, die traditionell mit Männern und Mannsein assoziiert werden. Es umfasst bestimmte Verhaltensweisen und -aspekte, die Männern zugeschrieben werden und kulturell anerzogen sind (Sozialisation). So werde Buben, Jungs und Männer von Geburt an dazu erzogen/angehalten, Schmerz und Trauer, Unsicherheit und Verletzlichkeit, „Weichheit“ und Sensibilität zu unterdrücken. Ein Motor hierfür ist die Sprache. Sprüche wie „Sei keine Pussy!“, „Das ist schwul!“, „Echte Männer weinen nicht!“ und „nimm das nicht persönlich“ und „wisch die Tränen weg“, weil Männer „stark“ sein und sich „nichts anmerken“ lassen müssen, verdeutlichen diese Sozialisierungsprozess.
„Männlichkeit“ ist somit eine geschlechtliche „Konfiguration von Praxis“ (Raewyn Connell). Das bedeutet, dass „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ von Connell als Positionen innerhalb des Geschlechterverhältnisses verstanden wird, die durch Praktiken unsere körperlichen Erfahrungen unsere Persönlichkeit wie auch unsere Kultur prägen.
Mehrheitlich wird „Männlichkeit“ als eine inhärente Charaktereigenschaft verstanden, d.h., dass das eigene Verhalten davon abhängt, was für ein Typ Mensch man ist. Unmännliche Menschen verhalten sich anders: eher friedlich als gewalttätig, eher versöhnlich als dominant etc. Ein Mann, der zu viel Emotionen zeigt, keine Lust auf Sex hat oder auf Frauen hört, gilt diesem Verständnis nach gesellschaftlich als weniger „männlich“. Erweitert wird dies durch Nicht-hetero-sein, trans sein, Dinge tun, sagen oder tragen, die nicht „männlich“ assoziiert sind (Christoph May).
Hier deutet sich eine weitere Relation der Praktiken an. „Männlichkeit“ braucht den Kontrastbegriff der „Weiblichkeit“. „Männlich“ und „weiblich“ werden als Antagonismen verstanden. Unsere heutige Gesellschaft ist geprägt von dem Verständnis polarisierender Charaktereigenschaften von Männern und Frauen.
Nach Connell strukturiert sich „Männlichkeit“ auf drei Ebenen. Erstens durch die Unterordnung von Frauen und die Dominanz von Männern (auch bekannt als Patriarchat). Zweitens mittels unserer Produktionsbeziehungen. So hat die wirtschaftliche Konsequenz der geschlechtlichen Arbeitsteilung zur Folge, dass die „Dividende“ aufgrund der ungleichen Beteiligung an gesellschaftlicher Arbeit für Männer größer ist wie für Frauen. Dazu kommt die ungleiche Verteilung gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kapitals zwischen Männern und Frauen (geschlechtsbezogener Akkumulationsprozess). Und drittens formen und realisieren die Praktiken unser individuelles Begehren oder in Connells Worten unsere emotionale Beziehungsstruktur.
Hegemoniale Männlichkeit
Das Konzept geht von verschiedenen Formen von Männlichkeit aus, die wiederum zueinander in einem Dominanz- und Unterordnungsverhältnis stehen. Jene „Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen Struktur des Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position“ einnimmt, wird von Connell als hegemoniale Männlichkeit gefasst. Diese kann und wird jederzeit in Frage gestellt, z.B. durch andere „Männlichkeiten“ sowie durch feministische Kämpfe.
Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Formen von „Männlichkeiten“ wird nach Connell durch folgende vier Merkmale strukturiert:
- Hegemonie: Zu jeder Zeit werde eine Form von Männlichkeit im Gegensatz zu anderen kulturell herausgehoben. Ihre hegemoniale Stellung entstehe, wenn es zwischen dem kulturellen Ideal und der institutionellen Macht (Politik, Wirtschaft, Militär) eine Entsprechung gebe. Es ist also jene Männlichkeitsform, die mit gesellschaftlicher Machtposition verbunden ist.
- Unterordnung: Die wichtigste Unterordnung sei die Dominanz heterosexueller Männer und die Unterordnung homosexueller Männer. Die Unterordnung lässt sich in einer Reihe „handfester Praktiken“ aufzeigen: politischer und kultureller Ausschluss, staatlicher Gewalt, wirtschaftliche Diskriminierung, Boykottierung der Person etc. Zudem werde alles, was „die patriarchale Ideologie aus der hegemonialen Männlichkeit“ ausschließe, dem Schwulsein zugeordnet, wobei Schwulsein mit Weiblichkeit gleichgesetzt wird. An dieser Stelle ist es wichtig, festzuhalten, dass Unterordnung auch heterosexuelle Jungen und Männer trifft. Die „Ausgrenzung aus dem Kreis der Legitimierten“ geschehe mittels eines Vokabulars, das die „symbolische Nähe zum Weiblichen“ offenbare (Schwächling, Schlappschwanz, Feigling, Waschlappen etc.).
- Komplizenschaft: „Männlichkeit“ wie auch „Weiblichkeit“ teilt – wie alle normativen Definitionen – das Problem, dass die normativen Ansprüche nur wenige Männer erfüllen. Connell betont, dass trotzdem die überwiegende Mehrzahl der Männer von der „Vorherrschaft dieser Männlichkeitsform“ profitiere, weil sie an der „patriarchalen Dividende“ teilhaben (siehe Produktionsbeziehungen).
- Marginalisierung: Hiermit beschreibt Connell die Beziehungen zwischen „Männlichkeiten“ dominanter und untergeordneter Klassen und ethnischer Gruppierungen. Zwar könnten Schwarze Sportler Vorbild für hegemoniale Männlichkeit seien, doch strahle ihr Ruhm und Status nicht auf die anderen Schwarzen ab und verleihe Schwarzen Männer nicht generell „ein größeres Maß an Autorität“.
Toxische Männlichkeit
Dieser Begriff umfasst die regressiven sowie destruktiven Praktiken und Verhaltensmuster, die durch (physische) Stärke, Mangel an Emotionen/emotionale Distanz, Hyperkonkurrenzdenken, Dominanz, Aggression, Einschüchterung, Bedrohung, Gewalt, sexuelle Objektifizierung und Abwertung von Frauen bzw. „Weiblichkeit“ sowie Trans- und Homofeindlichkeit geprägt sind.
Das Adjektiv „toxisch“ verdeutlicht, dass das Verhalten potenziell gefährliche und tödliche Konsequenzen für einen selbst so wie für andere innehaben kann (Suizid bzw. Femizide stellen die Spitze des Eisbergs toxischer Männlichkeitsmuster dar).
Einige Männlichkeitsanforderungen sind mit Versprechen verbunden. Eines dieser Versprechen ist es, souverän zu sein. Souveränität ist dabei oftmals mit einem Überlegenheitsanspruch verbunden (siehe oben). Vorherrschende Männlichkeitsversprechen führen zu einem Anspruchsdenken. Kurz gesagt lautet es: Je „männlicher“ du bist, desto mehr Anspruch hast du auf Respekt, Macht, Jobs und Sex. Wird dieses Anspruchsdenken verneint, löst das oftmals Aggression und Wut aus. Eng verbunden ist auf weiblich gelesene Körper und Aufmerksamkeit (von Frauen). „Männlichkeit“ und toxische Männlichkeit ist somit nichts, was Männer sind, sondern was sie tun. Und hier sollte geschlechterreflektierend Pädagogik ansetzen.
Geschlechterreflektierende Pädagogik
Pädagogisch ist es sinnvoll, grundsätzlich auf eine Entlastung von Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen hinzuarbeiten
Einerseits können Widersprüchlichkeiten in Männlichkeitsanforderungen und -versprechen herausgearbeitet werden. Vielversprechende ist es, Jugendliche von ihren Erfahrungen erzählen zu lassen, verstehend mitzugehen und auf Widersprüchlichkeiten hinzuweisen sowie in weiterer Folge eigene Verstrickungen in der Herstellung von Über- und Unterordnungsverhältnissen zu beleuchten. Wenn Jugendliche merken, dass sie Männlichkeitsanforderungen nicht erreichen können oder sie ihnen zu gewalttätig sind, sie ihnen selbst nicht guttun, sie soziale Kontakte verlieren bzw. sie sich als Belastung (Konkurrenz, Dominanz etc.) gestalten, entstehen Brüche, die eine Abwendung ermöglichen.
Andererseits zielt sie darauf ab, möglichst allen Schülern individuelle und differenzierte geschlechtliche Identifikation anzubieten. Sie strebt eine sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an, in der Schüler ohne Gefahr der Bedrohung ihre Identifikation entwickeln können. Die einzige Beschränkung ist, dass ihre eigene Identifikation nicht auf einer Diskriminierung anderer fußen darf.
Jonathan Herkommer ist Lehrer an einer BHS in Wien.