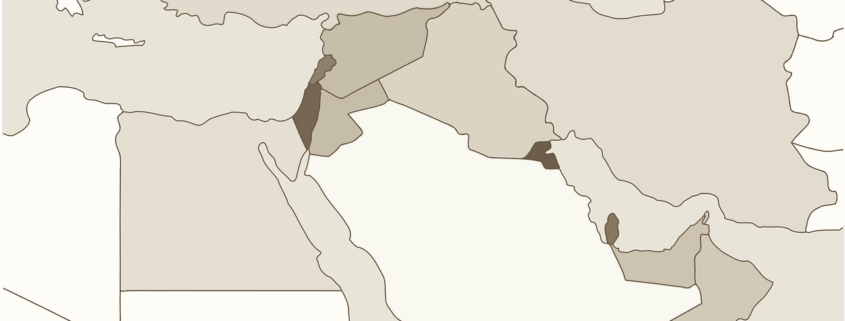Im folgenden Text möchte ich über meine Erfahrung als Lehrende an der Sommerschule 2023 berichten. Die letzten beiden Wochen hinterlassen viele Eindrücke, leider schwingt hauptsächlich die Realisierung mit, dass die Organisation und Administration des Projektes, sowie die unterstützende Begleitung von Lehramtstudierenden auf diesem Weg, komplett versagt hat.
Ich habe mit 1. September 2023, meinen Dienst im Rahmen der Sommerschule 2023 an einem Gymnasium im sechsten Bezirk beendet und schreibe aus Sicht einer Lehramtstudentin im Master, welche sich nach diesen zwei Wochen bezüglich der Organisation dieses Projekts deutlich vor den Kopf gestoßen fühlt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Hintergedanke der Sommerschule ein richtiger ist und halte auch den gewonnenen Erfahrungswert für Student:innen für nutzbringend. Allerdings finde ich es gleichermaßen wichtig, mitzuteilen, welche Zumutung die Organisation und Administration der Sommerschule in meinem Fall (und dem meiner Kolleg:innen) war. Gerade angesichts des derzeitigen Lehrer:innenmangels ist es meines Erachtens mehr als kontraproduktiv für alle Beteiligten, besonders auch für die Schüler:innen, so eine Arbeitsweise an den Tag zu legen.
Holpriger Start der Sommerschule
Schon2 Wochen bevor die Sommerschule startete, schrieb ich eine Mail an die Standortleitung, ob es möglich wäre, die Schule zu besichtigen und meine Gruppengröße wie auch die Schulstufe zu erfahren. Laut dem FAQ auf der Homepage des Bildungsministeriums sollte es schließlich auch vor dem offiziellen Start eine standortspezifische Konferenz geben. Letztendlich fand die erste Kommunikation erst am Samstag (19.8), zwei Tage vor dem Start, statt. Dabei wurde auch nicht auf nähere Fragen eingegangen, es wurde nur ein Rundmail an alle Unterrichtenden ausgeschickt, zwar mit einer Klassenliste, jedoch war daraus nicht ersichtlich, welche Schulstufe man bekommt. In der Mail wurde bedauert, dass man nicht auf Anfragen eingegangen ist, die Standortleitung sei die letzten Wochen auf Urlaub gewesen. Ich verstehe, dass man in den Sommermonaten zeitweise aufgrund von Urlaub unerreichbar ist, aber so lange und so knapp vor der Sommerschule sehe ich das nicht ein, vor allem wenn es sich nur um ein kurzes Mail zurück handelt, in dem es um essentielle Informationen geht.
Als wir schließlich am Montag in der Schule eintreffen, herrscht vollkommenes Chaos. Die Standortleitung händigt uns bloß die Schlüssel und ein Stück Kreide aus, führt uns aber nicht herum, gibt uns lediglich vage Beschreibungen, wo sich die Klassen befänden (als wären wir jemals vorher schon in dieser Schule gewesen). Zeit für Fragen gibt es keine mehr, beziehungsweise bekommen wir keine hilfreichen Antworten. Funktioniert der Beamer, das Internet? Das könne er uns nicht sagen, da „müsse man halt schauen, er sei die letzten Wochen auch nicht dagewesen“. Kann man irgendwo rausgehen, in den Hof oder den Turnsaal benutzen? Nein, die Schule würde gerade generalsaniert. Ich möchte an dieser Stelle erinnern, dass es in der ersten Woche durchschnittlich um die 35 Grad hatte. Man kann sich also vorstellen, wie schlimm dann die Atmosphäre in einer Klasse ist, in der die Jalousien teilweise kaputt sind und vorm Fenster Baustellenlärm herrscht. Ich frage mich, weshalb so ein Standort für die Sommerschule überhaupt ausgewählt wurde.
Zurück zum ersten Schultag: Bald kommen Eltern und Schüler*innen herein, diese irren herum, wir können ihnen auch nicht helfen, weil wir selbst einmal unsere Klassen finden müssen. Die Klassenlisten beim Eingang werden in letzter Sekunde von der Standortleitung aufgehängt, wir könnten ja stattdessen Auskunft geben und die Kinder in ihre Klassen lotsen. Nachdem sich das Chaos langsam legt, bemerke ich, dass ich statt dem vorgegegbenen Maximum einer Schüler:innenanzahl von 15 Schüler:innen, 19 Kinder bei mir habe, wobei sich alle Klassenstufen in meiner Gruppe befinden. Ich möchte dabei betonen, dass ich mich im Laufe meiner Ausbildung mit Differenzierung heterogener Lerngruppen und Projektarbeit auseinander gesetzt habe und ich auch weiß, dass ich eine kompetente Lehrperson bin. Allerdings ist es eine Zumutung, projektorientierten Unterricht planen zu müssen, in dem auf individuelle Bedürfnisse eingegangen wird, wenn ich gleichzeitig 11- bis 14-jährige Lernende da sitzen habe und keinerlei Ressourcen zu Verfügung gestellt bekomme.
Unterstützung seitens der Standortleitung
Laut der Homepage des Bildungsministeriums „unterstützt die Sommerschulleitung bei der Planung und Organisation der Sommerschule am Standort“. Leider haben meine Kolleg:innen und ich das überhaupt nicht so empfunden. Die Standortleitung ist entweder nicht imstande, unsere Fragen zu beantworten (beispielsweise wie der Beamer funktioniert: „das kann ich nicht sagen, da müssen Sie schauen“) oder ist nicht aufzufinden. Wir bekommen nie eine Telefonnummer, es gibt keinen Raum oder Zeit für interne Vernetzung. Beispielsweise wäre es sehr praktisch, bei den umherirrenden Eltern eine Ansprechperson weitergeben zu können, jedoch werden wir auch nicht informiert, wo sich der Zuständige befindet. Ich finde ihn selbst irgendwann einmal in der Bibliothek. Uns teilt er nicht mit, dass er sich dort befinden wird. Ich kümmere mich währenddessen darum, dass eine WhatsApp-Gruppe entsteht.
Die Standortleitung kommt nur vorbei, um Anwesenheitslisten einzusammeln oder mit dem Dienstvertrag, den ich auf der Stelle unterschreiben soll. Ich bekomme keine Zeit, ihn mir näher anzusehen. Von ihm kommen keine Informationen, erst auf Nachfrage, wie wir vorgehen sollen, wenn Schüler:innen beispielsweise nicht erscheinen, gibt es eine Antwort, jedoch scheint er sich hier selbst unklar. Die Kontaktdaten der Schüler:innen mitsamt Telefonnummern der Erziehungsberechtigten erhalten wir erst am 23.8. Auf Nachfrage, was wir tun sollen, wenn sich ein Kind verletzt, heißt es bloß, dass die Schüler:innen ja eh selbst ein Handy mithätten, wo sich die Nummern drin befänden. Hier möchte ich wissen, was ich dann machen soll, wenn in Ernstfall ein Kind bewusstlos ist und ich nicht weiß, wie ich das Handy entsperren kann. Weiters bekommen wir zwar Schlüssel bekommen, jedoch funktionieren diese erst ab 8:00 Uhr. Dies ist sehr kontraproduktiv, wenn man um 7:15 Uhr vor der Schule steht, die Klasse vorbereiten, kopieren oder auch die Toilette benützen möchte.
Mangel an Ressourcen
Während der ersten Woche merke ich bald, dass ich aufgrund der verschiedenen Schulstufen in meiner Gruppe weitaus mehr Material benötigen werde, als ich mir vorgestellt habe. Natürlich könnte ich auch irgendwelche Arbeitsblätter aus dem Internet vorlegen, jedoch verdienen diese Kinder auch qualitätsvollen Unterricht. Außerdem versuche ich stets, sie bei dieser Hitze und dem Mangel an Ressourcen (Beamer funktioniert erst am dritten Tag, Kopierpapier ist immer wieder mal leer) zu motivieren. Ich beginne also, aus eigener Tasche Materialien zu besorgen. Laut Ihrer Homepage sind „Materialkosten, die zur Durchführung der Sommerschule anfallen, vom jeweiligen Schulerhalter zu tragen“. Das war bei uns natürlich nicht der Fall. Mir ist bewusst, dass es meine Entscheidung und Verantwortung ist, ob und zu welchem Preis ich Material besorge. Allerdings möchte ich aus oben genannten Gründen den Schüler:innen qualitätsvolle Förderung sowie ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Leider konnte ich mir auch keine Ideen aus einer Begleitlehrveranstaltung holen, da ich mich bereits im Masterstudium befinde und daher seitens der Universität Wien nicht mehr an einer solchen teilnehmen durfte, diese sei nur für Bachelorstudierende gedacht.
Ich habe bereits 2020 im Rahmen der Sommerschule unterrichtet und es macht mich nach wie vor wütend, wie wenig Studierende auch in Bezug auf Materialien unterstützt werden. Wieso gibt es heuer nicht wieder einen Sozialtopf für zusätzliche Kosten in Kooperation mit der ÖH? Die Lebenserhaltungskosten sind für arbeitende Studierende sowieso schon eine Zumutung. Da läuft dieses Projekt bereits das dritte Jahr und noch immer gibt es keine Unterstützungsangebote bezüglich Material. Man lernt natürlich im Laufe der Ausbildung, wie man Stunden plant, aber wie bereits erwähnt, nicht in derart heterogenen Lerngruppen und mit dem Anspruch auf Projektunterricht – allerdings ohne jegliche Ressourcen. Wieso kann man nicht beispielsweise Studierenden während dieser zwei Wochen Zugriff auf digitale Schulbücher (Stichwort digi4school) geben? Davon würden doch auch die Schüler:innen selbst profitieren. So könnte man wenigsten schon mal sehen, mit welchem Stoff sie sich im vorherigen Semester auseinander gesetzt haben sollten.
Das Chaos ist noch nicht zu Ende
Zu Beginn der zweiten Sommerschulwoche setzt sich das Chaos fort. Eltern sowie Schüler:innen überraschen uns zu Unterrichtende mit dem Anliegen die Gruppe zu wechseln. Manche möchten eine Woche beispielsweise Englisch besuchen, in der zweiten dann aber Mathematik. Wir hören zum ersten Mal etwas davon. Die Standortleitung ist nicht im Haus, der unterstützende Lehrer an der Schule beginnt selbst erst im September an diesem Standort zu unterrichten und hat noch nichts von der Wechselmöglichkeit gehört. Eine Mutter berichtet mir auch, dass sie der Bildungsdirektion bereits vor Beginn der Sommerschule drei Mails im Laufe des Sommers geschrieben habe, ob ein solcher Wechsel nach einer Woche möglich sei. Sie erhielt nie eine Antwort.
Abschließendes Resümee
Zu guter Letzt möchte ich noch einmal betonen, dass ich das Projekt Sommerschule grundsätzlich für sehr sinnvoll halte. Ich habe auch den Eindruck, dass meine Schüler:innen sich etwas mitnehmen und ihr Wissen aufbessern konnten sowie gerne gekommen sind. Allerdings liegt das daran, dass ich zu teilweise furchtbaren Arbeitsbedingungen mein Bestes gegeben habe um ein motivierendes und funktionierendes Programm zusammen zu stellen. Der Stundenlohn passt auch nicht mit dem Arbeitspensum zusammen, wenn ich mich mit so viel organisatorischen Malheurs herumschlagen muss und bis in die Nacht hinein Stunden plane, die 11- sowie gleichzeitig 14-jährige Schüler:innen anspricht. Ich arbeite gerne und scheue auch nicht vor Arbeit zurück, jedoch vergeht einem die Lust an diesem eigentlich sehr erfüllenden Beruf, wenn man in solch einer Art und Weise seitens der Administration behandelt wird. Darunter leiden alle Beteiligten. Am Ende auch die Schüler:innen.
Hier haben die organisierenden Instanzen gänzlich versagt und mir ist es ein Anliegen, darüber zu informieren, damit es die nachkommenden Studierenden und Schüler:innen vielleicht besser haben. Ich hatte eine tolle Zeit mit meinen Schüler:innen und habe viel gelernt, allerdings würde ich unter solchen Bedingungen nie wieder an der Sommerschule teilnehmen und auch anderen davon abraten. Man sollte überdenken, welche Personen als Standortleitung eingestellt sowie welche Standorte ausgesucht werden und wie man Studierende besonders bezüglich des Materials unterstützen könnte. Es braucht eine bessere Kommunikation und Organisation, das schuldet man allen Beteiligten.
Die Autorin ist Studentin und war Lehrende an einer Sommerschule in Wien