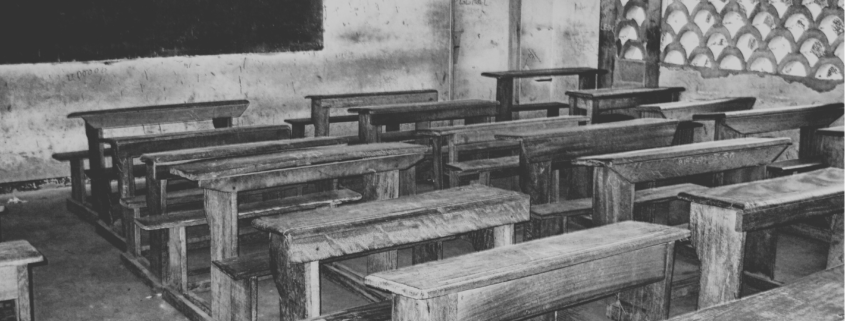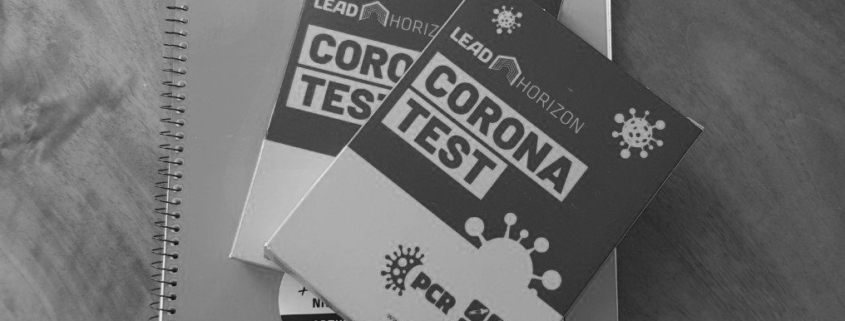Anmerkung: Bei den Schreibarbeiten zu diesem Text kam niemand zu Schaden. So soll es auch beim Lesen sein. Ein etwas anderer Blickwinkel kann aber derzeit nicht schaden. Wenn sich jemand gekränkt fühlen sollte, dann bittet der Autor vorbeugend, nicht nachtragend zu sein, denn dies ist keineswegs die Absicht des Textes.
Der ewige Lockdown
Nun befinden wir uns gefühlt in einem sich selbst ewig verlängernden Lockdown, der nicht wenige bereits in ein Down lockte. Die Maßnahmen sollen noch härter werden. More of the same. Wir werden sehen. Vielleicht wird’s ja noch ein Stopp and Go. Wenn dann die Frisörläden hoffentlich Sommer 2047 wieder dauerhaft ihre Pforten öffnen, benötige ich dringend einen Locken-down, denn die ewigen Corona-Dauerwellen spiegeln sich derweil in meiner Coronafrisur wider, die gerade noch für das Home Office geeignet zu sein scheint. Ich überlege mittlerweile, ob ich nicht das Feature „Mein Erscheinungsbild retuschieren“ aktiviere.
Mein Bart ist auch brav rasiert, die FFP2-Maske fordert Tribut. Vorher sah ich einem Mann ähnlich, jetzt mit der Maske eher einer um Luft ringenden, gerade aufgetauchten Ente. Ich hoffe, meine Schüler*innen erkennen mich wieder, wenn ich sie in der Schule irgendwann treffe.
Ich watschle mit meinem Lockdown-Gewicht und Locken-Gesicht zum Spiegel, überlege mit einer Mischung aus Amüsement und schleichendem Stechschmerz ob des Anblickes folgendes Gedankenexperiment:
Unser Land als Schulklasse
Wie wäre es, wenn wir unser Land mal als Schulklasse betrachten würden? Eine Schulklasse, die unsere Gesellschaft widerspiegelt. Alle Altersstufen, Geschlechter, Religionen usw. kommen ihn ihr vor. Die Regierung: Das wären dann die Pädagog*innen und die Klassenlehrer*innen. Die Schulleitung repräsentiert übergeordnete Stellen. Nun kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass ich bei meiner Ausbildung zum Pädagogen unzählige Male lernte, dass Angst – und Schuldpädagogik einer grauen Vergangenheit angehören würden. Differenzierung wäre das Maß der Dinge und eine neue Fehlerkultur wäre neben positiver Motivation Teil des pädagogischen Lern- und Erfolgskonzeptes. In dieser pädagogischen Ausrichtung wären unsere Kinder und Jugendlichen Hoffnungsträger, junge Menschen, die als mündige Bürger in eine freie Demokratie begleitet werden sollten. Alles andere würde zu einem negativen Lernklima führen und das Lernpotential wäre gehemmt. Nun, wie sieht es derzeit aus? Haben wir diese „Lehrer mit Klasse“ im doppelten Sinne?
Die großen Werte in Zeiten von Corona
Um gleich auf den Punkt zu kommen, ich beobachte Folgendes: Diese großen Werte wurden mit der Corona-Krise über Bord geworfen bzw. umgedeutet. Alte Werte sind das neue Maß. Das Kind wurde nicht nur sprichwörtlich, sondern buchstäblich mit dem Bade ausgeschüttet. Gleich zu Beginn der Krise fand sich das spektakuläre interne Strategiepapier der deutschen Regierung. Wenn wir bei unserem Vergleich bleiben, dann wäre dieses wie der neue „pädagogische Maßnahmenkatalog“ des fiktiven Bildungsministeriums für unsere Schulklasse. Nun, was findet sich in diesem? Unter 4a werden „Worst-case-Szenarien“ als Mittel der Wahl empfohlen. Qualvoller Erstickungstod, arbeiten mit Urängsten, Schuld am Tod der Großeltern usw. werden als pädagogische Schock-Maßnahmen in diesem staatlichen Lehrplan beworben. Das Papier ist eigentlich eine verdeckte Wegkarte zum Traumatherapeuten der Wahl. Diese neuen Richtlinien spiegeln sich in den Unterrichtsmedien wider, die die Schüler*innen, also wir alle, konsumieren.
Die medialen Beiträge richten nach unten, statt aufzurichten. Und das stündlich, täglich – seit Monaten.
Die neue Expertokratie
Expert*innen werden zu Rate gezogen. So viel, dass wir von einer Expertokratie der ewig selben Expert*innen sprechen können. Gut, die Lage ist prekär. Die Schule kennt diese Vorgehensweise mit Expertisen nur allzu gut, besonders dann, wenn Expert*innen ihre Einschätzung aus Elfenbeintürmen verkünden. Diese sprechen nun aber keine tröstlichen Worte, sondern Monate hindurch wiederkehrende drostliche. Und natürlich irgendwie weltfremde. Eine einzige tröstliche Botschaft in all den Monaten? Fehlanzeige. Ausschließlich drostliche.
Ich merke meine Sehnsucht nach positiven, differenzierten Beiträgen, nach denen ich mich recke und strecke. „Bist du noch bei Drosten, Gates noch?“, muss ich mir daraufhin von empörten Mitbürger*innen anhören. In der Klasse herrscht ausschließlich Frontalunterricht. Keine Differenzierungsmaßnahmen mehr. Klassenfahrten, Praktika, Sprachreisen, Schullandwochen usw. werden gestrichen. Andere Klassen dürfen nur in Ausnahmefällen besucht werden. Besonders über die Schwedenklasse lästert man. Die Klassenkassa dünnt langsam aus. Der Kompetenzkatalog wird gerade noch abgehakt. Immerhin sollen wir noch funktionieren.
Ab nach Hause!
Aufgrund der Gefahr für die älteren und vorbelasteten Schüler*innen werden nun alle Schüler*innen nach Hause geschickt. Fernlernen ist angesagt. Eine ältere Klassenkollegin meint: „Warum bleiben die Jüngeren nicht hier? Ich hab nichts davon, wenn die auch alle nach Hause müssen. Außerdem fehlt dann Geld in der Klassenkassa.“ Ihre Wortspende wird als unsolidarisch und zu wirtschaftsfreundlich abgeurteilt. Jeff, der mittlerweile die Schulbücherei und vieles mehr übernommen hat, lächelt, während er seine Bezos zählt. In die Klassenkassa zahlt er nichts ein. Wenn wir zu Hause brav sind, dann kommt auch das Christkind und später der Osterhase, wird uns erklärt. In Österreich werden sogar Babyelefanten zum Abstandhalten verschenkt. Später gilt der Bildungsminister als genormtes Abstandsmaß. Ein „Faßmann“ ist dann gleich so viel wie zwei Meter. Zwei Meter Abstand? Echt? Ich genehmige mir einen Flachmann.
Testen, testen, testen!
Weiterhin lernen alle dasselbe. Differenzierung zählt nun als unsolidarisch, das „Über- einen- Kamm-scheren“ als die neue Solidarität. Wer besonders heftig Angst verspürt, gilt ab jetzt als empathisch und wird hervorragend benotet. Generell dominiert nun, was in der Schule schon seit einigen Jahren gelebte Praxis ist: testen, testen und nochmals testen. Flächendeckend. Nach PISA nun der PCR-Test. Nach OECD nun WHO. Klassenrankings werden auf Dashboards im Dauertakt in den leitenden Unterrichtsmedien veröffentlicht. Die Tests sind teuer, die Stäbchen der neue Maßstab.
Umkehrung der Werte
Negativ gilt plötzlich als positiv. Die alten Werte sind die neuen. Die ehemals hinten rechts Sitzenden kämpfen zur Überraschung der Freiheitsliebenden aggressiv für Grund- und Präsenzrechte. Die Kritischen, die früher gerne friedlich links vorne neben dem offenen Fenster saßen, müssen in Zukunft auch bei denen hinten rechts sitzen, meinen die Lehrer*innen. Moralisch sich upgradende Denker lesen nun ausschließlich Leitmedien. Die Welt ist kehrvert. „Sie sind mit Abstand die beste Klasse!“, läuft als Werbeslogan über die Bildschirme. Vor einem Jahr wäre diese Aussage noch positiv konnotiert gewesen. Jetzt isoliert uns diese Botschaft. Noch dazu kein Singen, Tanzen, Umarmen, laut Lachen, Feiern. Ein „Aerosolemio“ – und schon schwingen sich die Aeorosole zu einem Tröpfchencluster hoch.
Ökonomisierung der Schule
„Wir sollten das lehren, was uns von Robotern unterscheidet“, hatte Jack Ma einmal gemeint, als er noch seine Meinung sagen durfte, ohne untertauchen zu müssen. Oder untergetaucht zu werden… Die Klasse, ja die ganze Schule wird ökonomisiert. Neue Leute geben den Ton an, wie die personifizierte Daueralarmglocke von Charité. Oder Bill, der neue Freund, der große Bruder und reiche Onkel. Er kennt sich bei Viren aus. Durch sie lassen sich nach Resets immer wieder neue, beherrschende Betriebssysteme verkaufen und implementieren. „Kann man Freunde kaufen?“, will jemand beim Fernlernen über Teams wissen, das irgendwie auch zu Bill gehört. „Nein, keine echten. Aber dafür der Titel Menschenfreund.“ „Kann man sich dann noch in den Spiegel schauen?“ „Oja, für 2,5 Millionen Dollar. Kein Problem.“
Wir sind zu Virenträgern geworden, potentielle Gefährder
Die Jüngsten unter uns mutierten sogar vom Hoffnungs- zum Virenträger. Sie leiden, meist stumm. Selten an der Krankheit, oftmals an der Angst, Schuld und Einsamkeit. Sie tragen den Lockdown mit. Und sie tragen die Gesundheits-, die Schulden- und die Umweltlast. Zumindest in der Zukunft. Hoffentlich sind sie dann nicht nachtragend. Vorbeugend werden sie jedenfalls zuhause gelassen, viel zu viele finden sich jetzt in einem psychischen Knockdown wieder. Die Schulpsychologie muss immer wieder triagieren. Wie das Verlassen des Beichtstuhls empfinden einige das Gefühl nach einem negativen Corona-Test. Negativ ist gleichbedeutend mit einem sündenlosen Körper. Sind Virologen auch mutiert – zu unseren neuen Hohepriestern im weißen Kittel in heiligen Laboren, das patentierte Orakel namens PCR-Test befragend? „Wenn ich das Orakel mehr als dreißig Mal befrage, erhalte ich ziemlich sicher eine positive Antwort“, erklärt Robert, der gerade seine eigene Suppe in seinem Labor kocht.
Die Fehler-Politik
Stündlich erfahren wir, welche meist älteren Klassenkollegen wieder verstorben sind. Es ist sehr traurig. Das Durchschnittsalter beträgt über 80 Jahre, aber natürlich sterben manchmal auch Jüngere. Wir konzentrieren uns im Unterricht auf Todesfälle und Erkrankungen. Es ist beängstigend. Ich weiß noch, wie vor Jahren an den Schulen begonnen wurde, bei Tests die korrekten Ergebnisse zuerst auszuweisen, danach die Fehler. Unsere Corona-Lehrer*innen aber wurden von der Direktorin mit einem säuerlichen Lächeln angewiesen, ausschließlich die Fehler zu veröffentlichen. Die korrekten Antworten werden ausgeblendet. Die Verbesserungen auch. Alles wird von einem Experten – ich nenne ihn mal Johns – auf einer speziellen Tafel, einem sogenannten Dashboard, international ausgewiesen. Die Fehler wachsen und wachsen.
Der Ausblick ist düster. Positives Denken und Optimismus gelten mittlerweile als psychische Erkrankungen. Bei Fehlverhalten werden nun auch die Mitschüler*innen jedes Alters angehalten, dies unverzüglich der Schulleitung zu melden.
Ein neues Schulfach wird eingeführt: Virologie
Ökologie, Psychologie, Soziologie, politische Bildung, Geschichte werden vom Lehrplan gestrichen. Neue Wissenschaftlichkeit nennt sich dies. Orchideenfächer wie Musik, Sport und Werken werden abgeschafft. „Sind die alle verwirrt? Das ist doch ein lupenreiner Tunnelblick“, findet ein Klassenkollege. „Wir sind alle schon ver-virt“, gebe ich bei der Videokonferenz zur Antwort. „Bald haben wir einen Lach-down.“ Der Lehrer verwarnt mich, als ich noch von „Wirr-ologie“ und vom Wirt rede, den ich dringend brauche wie ein Virus. Als ich dann behaupte, Corona wäre mittlerweile mehr Spaltpilz als Virus, beschimpft er mich als Verschwörungstheoretiker und stummt mich. Der Lehrer erklärt dann noch, dass die Grippe heuer keine Chance habe. Ein Schüler, der ihn daraufhin „Influenza-Leugner“ nennt, wird auch gestummt. Eine Klassenkollegin, die gesteht, dass das Unter- und Nachrichten sie nach unten drücke, drückt der Lehrer weg. Neue Toleranz und Liberalität nennt er dies später. Da eh alles verdreht zu sein scheint, verdrehe ich die Buchstaben von Pfizer und öffne den Drehverschluss von meinem Zipfer.
Unter-richten statt aufrichten
Eine Zeitung im Süden Deutschlands interviewt Bill. Er freue sich schon auf die nächste Pandemie, meint er. Zehnmal stärker werde sie. Ich sehe ihn lächeln. Wieso weiß er das? Die neue Realität also. Unterrichten statt aufrichten. Das neue pädagogische Konzept. Wer dagegen aufbegehrt, gilt als empathielos und intelligenzfrei. Außerdem wären Menschen schlechte Wirte. Technokraten würden uns schon in optimierte Maschinen verwandeln, dann hätten wir das Potential, auch Computerviren zu tragen. Neuroverlinkte Doppelvirenträger. Schöne, neue Welt. Die neue Normalität. „Wir müssen einfach besser zurückbauen“, meint der Klaus vom Schulforum. Er ist wieder mal in eine Besprechung geschwabt.
Ausblick
Zum Schluss aber wagen wir aber doch einmal einen unverschämt positiven Blickwinkel: Stellen wir uns vor, die Pädagog*innen und Expert*innen führen uns statt in den Nebel in das Leben.
Vielleicht haben sie das Wort Nebel nur verkehrtherum gelesen, weil gerade alles etwas kehrvert läuft? Sie haben ab jetzt bei allen Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit im Auge, ohne zu verharmlosen. Sie geben ermutigende Ziele vor und glauben an die Schüler*innen. Neue Expert*innen erscheinen auf den Bildschirmen. Nicht mehr jene, deren Botschaft auf uns hereinprasselt wie ein mitleidloser lauter Bach, uns in Formation bringend. Sie begeistern uns für eine achtsame, gesunde und ökologische Lebensweise und sehen die Krise als Chance. Sie wissen: Wir sind freie Wesen mit unantastbarer Würde. Sie erklären, wir sollten den Wirt heilen und nicht das Virus bekriegen. Sie wissen auch um die Weisheit des ungesicherten Lebens. Die neuen Lehrer*innen lassen die Jüngeren unter uns wieder leben und schützen die Älteren besser und transparenter als die Monate zuvor. Sie leben Differenzierung, Pädagogik ohne Angst, positives Denken, wertschätzende Beurteilungen.
Sie halten Versprechungen ein und sehen die Jüngsten als Hoffnungs- statt Virenträger.
Ich sehe vor meinen Augen die derzeitigen Pädagog*innen – und male mir aus, ob sie das schaffen. Mir wird schwarz vor Augen.
Vielleicht könnte eine verpflichtende psychotherapeutische Begleitung für diese Pädagog*innen helfen. Behandeln wir nicht ständig psycho-therapeutisch sowieso die Falschen? Vornehmlich jene, die an den kranken Maßnahmen erkranken? Bevor wir die Pädagog*innenen in diesem Beispiel therapieren – sollten wir uns nicht davor noch schnell von den Psychopath*innen verabschieden und diese isolieren? Wie wäre es mit Psychopath*innen-Tests bei unseren Lehrer*innen? Wahrscheinlich ist der neue Anal-Abstrich aus China für solche Tests gedacht. Vielleicht bräuchten wir dann kaum noch Therapien, da zu viele Ärsche positiv auf den Psychopath*innen-Test getestet würden. Dann bekommt die „Heimquarantäne“ auch wieder eine andere Bedeutung. Und sogar die Spritze.
Auf einen neuen Weg raus aus dieser Krise!
Mit dem alten Richten nach unten wird’s ganz sicher nichts. Mit den alten und echten Rechten, die nach Freiheit grölen und das Recht mit Füßen treten, auch nichts. Und was machen wir, wenn die jetzigen Pädagog*innen weiterhin nicht als gute Hirten taugen? Wir führen uns selbst aus dem Sumpf und richten uns auf. Wir verzichten auf Lehrkräfte, die nach unten richten. Wir lernen aus eigener Kraft. Wir wissen die Richtung. Die Reise beginnt mit dem Selbstwert. Die neue Pädagogik ist unser Kompass. Und bei dieser begleiten in Zukunft die Lehrer*innen nur mehr. Sie richten nicht. Höchstens auf!
Gerald Ehegartner ist Lehrer an einer Mittelschule in Niederösterreich.