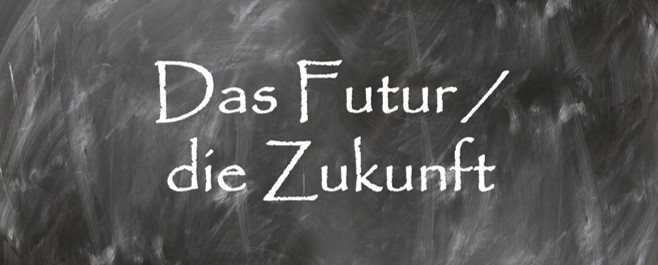Kurz vor den Sommerferien des denkwürdigen Schuljahres 2020. Im „ausgedünnten“ Klassenzimmer dümpeln 10 müde Schüler*innen dahin. Sie haben eine lange Phase des Homeschooling hinter sich und ein paar merkwürdige Schulwochen unter widrigen Bedingungen. Das bereits erworbene Wissen wurde vielfach wieder vergessen, es fällt den Kindern zunehmend schwerer, sich an den „Hausaufgabentagen“ zu ihren Aufgaben zu motivieren. Auch mir fällt es derzeit schwer, als Lehrkraft motiviert und optimistisch zu bleiben …
Wir wiederholen zum gefühlt dreihundertsten Mal das Futur. An die Tafel schreibe ich Beispiele; achte darauf, dass sie der Lebenswelt der Kids entsprechen: Ich werde ins Kino gehen. Du wirst einkaufen fahren. Er/Sie/Es wird in die Schule kommen. Wir werden in den Park gehen. Ihr werdet die Jause essen. Sie werden …
Ich werde von einem Geräusch unterbrochen. In der Tür stehen zwei junge Männer in schwarzen Anzügen mit blütenweißen Hemden und schmalen Krawatten. Einer hat einen John-Lennon-Look, der andere eine Frisur wie aus einem Tarantino-Film. Sie winken, grinsen. An ihren Sakkos prangen kleine Abzeichen der HTL. Jetzt erkenne ich die beiden. Es sind meine ehemaligen Schüler, A. und M. Vor mittlerweile fünf Jahren habe ich sie in meinem ersten zwei Jahren als Lehrerin in Deutsch unterrichtet. Wir haben die beiden damals als Lehrer*innenteam stark gefordert, immer wieder zu besseren Leistungen gedrängt und ihnen zuletzt guten Gewissens Noten gegeben, die ihnen einen Eintritt in eine weiterführende Schule ermöglicht hatten.
Die Wiedersehensfreude ist groß. Ich bitte sie in die Klasse und sie erzählen, dass sie gerade maturiert haben. Sie zeigen die kleinen Nadeln an ihren Anzügen her; eine ist silbern und steht für einen guten Erfolg, die andere ist golden und belegt die Matura mit Auszeichnung. Die 1B ist plötzlich aufmerksam und wach. Sie erzählen den Kids von ihrer Schulzeit an der NMS, geben Tipps, machen ein paar witzige Bemerkungen über mich und berichten, wie sehr ihnen unsere Schule geholfen hat, ihren Weg zu gehen. Next step: Uni.
Ich freue mich unglaublich und spüre, wie meine Motivation wieder erwacht. Wir machen ein Selfie zur Erinnerung an diesen besonderen Moment. Im Hintergrund prangt das Tafelbild mit der symbolträchtigen Überschrift „Das Futur / die Zukunft“.
Nachdem die beiden weg sind, vervollständige ich das fehlende Beispiel an der Tafel:
„Sie werden maturieren.“
Die Autorin ist Lehrerin an einer Mittelschule in Wien.