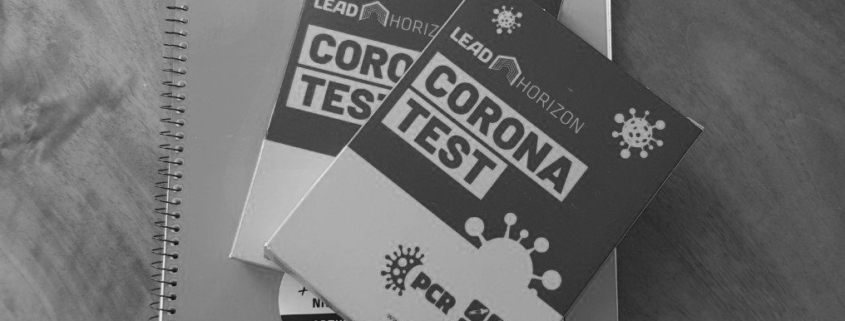Willkommen, willkommen! Treten Sie ein!
Beim Betreten des hellen, lichtdurchfluteten Schulgebäudes begrüßt mich eine geräumige Aula mit einladenden Sitzflächen und viel Grün. Die Wände dokumentieren die unterschiedlichsten Projekte der Schüler*innen. Mit mir strömen mehrere Schüler*innen ins Gebäude. Die meisten Schüler*innen kämen eine halbe Stunde früher, erzählt jemand von der Schulleitung. Viele würden sich am Buffet ein kostenloses Frühstück holen, zum Lesen oder Social Media Update in die Bibliothek gehen bzw. sich mit ihren Freund*innen für eine Runde Tischtennis oder zum Austausch über den neuesten Gossip treffen. Mein wandernder Blick erheischt einige dieser gerade mitgeteilten Momente. Großzügige Aufenthaltsräume und -plätze mit verschiedenen Sitz- und Liegemöglichkeiten laden zum Verweilen, Arbeiten und Zusammensein ein.
Architektonisch orientiert sich das Gebäude nicht mehr an vielen, hermetisch abgeschlossenen, ehemals Klassenzimmer genannten Räumen. Vielmehr gibt es fachbezogene Räume. Diese sind mit den entsprechenden Utensilien ausgestattet und werden von den Schüler*innen aufgesucht, wenn sie sich mit dieser Thematik beschäftigen wollen. Dieselben weisen keine Reihe von Tischen und Stühlen auf, sondern sind mit Tischinseln und diversen Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten ausgestattet. Je nach Bedarf gibt es so genug Platz für Einzel- bzw. Gruppenarbeiten. Wo gearbeitet wird, ist den Schüler*innen offen gelassen. Des Weiteren ist jeder der Räume mit dem höchsten Stand der Technik ausgestattet und verfügt über vielfältiges Arbeits- und Bastelmaterial, sodass keiner Gestaltungskreativität Einhalt geboten ist. Räume und Gebäude ohne PCs, Tablets und Beamer oder gar WLAN sind unvorstellbar.
Neben der Raumgestaltung hat sich auch der sogenannte Stundenplan verändert. Während der Vormittag überwiegend mit Lernsettings des Sach- und Fachunterrichts aufgebaut ist, schreiben sich die Schüler*innen nachmittags, nach einem gratis Mittagessen aus lokalen und biologisch angebauten Nahrungsmitteln, für Kurse ein. Diese können je nach Interesse sowie Neugier und für die Länge eines Semesters ausgewählt werden. Das Angebot reicht von vielfältigen Sportaktivitäten über Theater und Kunst bis hin zu Vertiefungskursen des Sach- und Fachunterrichts als auch Gartenbau und landwirtschaftlichen Kursen. Selbige sind nicht nach Geschlecht oder Alter getrennt und werden selbstredend von einem diversen Team organisiert und betreut. Dass viel zu lange andauernde in Reih und Glied sitzen und vorgekauten Stoff konsumieren ist passé. Heutzutage entscheiden die Kinder und Jugendlichen mit welchen Inhalten und mit welchen Schwerpunkten sie sich im Semester auseinandersetzen wollen. Diese Kurse lassen sich jedes Semester neu wählen. So können unterschiedlichste Eindrücke gewonnen werden. Gleichzeitig können bei Fortführung Vertiefungskurse belegt und so ein immer größeres Expert*innenwissen aufgebaut werden.
Der Schulort ist ein Ort der gelebten Demokratie. Die Leitung besteht aus einem gewählten Team, das sich die Aufgaben und Verantwortlichkeiten untereinander aufteilt. Unterstützt werden sie von einem personell ausreichend ausgestatteten Büro und Administration. Psycholog*innen und Sozialarbeiter*innen, die ausschließlich unserem Standort zugeteilt sind, ergänzen die psychosoziale Infrastruktur der Schule. Das Team stellt sich nach jeder Periode zur Wiederwahl. Schulinterne bewerben sich um Positionen innerhalb der Schule. Eltern und Schüler*innen haben eine jeweilige, gewählte Vertretung. Das Schulparlament trifft sich einmal im Monat zu Sitzungen und Abstimmungen zu Schulangelegenheiten. Da mittlerweile nur noch eine 25 Wochenstunde vorherrscht, Lehrer*innen mehrsprachig sind sowie Simultanüberstetzungen selbstverständlich sind, haben Eltern Zeit und Sprachbarrieren als Ausschlussmechanismus gehören der Vergangenheit an.
Kommen Sie näher und staunen Sie
Die Lernstation „Design your Life“ ist heute gut besucht. Über 20 Kinder und Jugendliche arbeiten altersübergreifend an ihrem persönlichen „Sinn“ des Lebens. Dazu haben die Lernbegleiter*innen verschiedenes Material und Modelle vorbereitet. Intensiv besucht ist auch der Exchange Room, der völlig selbstverständlich in mehreren Sprachen gleichzeitig stattfindet. Schüler*innen tauschen sich hier nach klassischen Regeln des radikalen Respektes miteinander aus, präsentieren Ideen und suchen Unterstützung und Feedback. Die mehrsprachigen Lernbegleiter*innen, die den Exchange Room moderieren, können selbst auch beitragen. Im Rahmen ihrer Ausbildung haben sie die üblichen Sprachstudien gemacht, sprechen mindestens zwei Fremdsprachen, wovon eine nicht europäischer Herkunft ist und kamen somit auch in den Genuss , eine völlig fremde Schrift zu erlernen. Im Rahmen ihres Auslandssemesters durften sie selbst im außereuropäischen Ausland leben, arbeiten und die Erfahrung machen, wie man sich in einer fremden Kultur, Schrift und Sprache zurechtfindet. Diese Erkenntnis ist obligatorisch, wenn man in Wien an einer Schule mit multiethnischer Schüler*innenschaft arbeiten möchte und hilft immens, sich in die Kinder und Jugendlichen, die ganz selbstverständlich altersübergreifend unterrichtet werden, hineinzuversetzen. Längst sind überall Videodolmetscher*innen implementiert, um die Zusammenarbeit mit den Eltern zu erleichtern und vor allem, um das Defizitgefühl der Eltern aufzufangen, wenn sie die deutsche Sprache nicht beherrschen. Schon lange verlangt man nicht mehr die deutsche Sprache von den Zugewanderten sondern sieht die multilinguale Kommunikation als eine große Bereicherung für diese schon immer mehrsprachig gewesene Stadt. Zu wichtig sind die Qualifikationen und Kompetenzen, die Menschen aus anderen Ländern in diese Stadt bringen, als dass man diese monate- und jahrelang mit ineffizienten Deutschkursen schikanieren muss. Da der Druck nun weg ist und „das Eintrittsticket in die Gesellschaft“ wegfällt, kommt die gemeinsame Sprache sowieso. Die Ghettoisierung hat sich durch die Gesamtschule weitestgehend aufgehoben, alle Kinder werden nun von gleich gut ausgebildeten Lehrkräften auf ihrem Lernweg begleitet und unterstützt.
Erfolgreich hat sich die Gewerkschaft dafür eingesetzt, dass alle Lehrer*innen, denen die neue Ausbildung noch nicht zu Teil wurde, alle 10 Jahre ein verpflichtendes Jahr in der Wirtschaft verbringen, um verschiedene Berufe kennenzulernen und ihren Schüler*innen besser und lebensnäher beim Berufseinstieg, beim Formulieren von Bewerbungen und bei der Berufswahl helfen können, weil sie selbst Spezialist*innen darin sind.
Teamteaching ist ebenso Teil der Ausbildung und über das reine Vermitteln von Unterrichtsstoff im Frontalformat lacht man heute, im Jahr 2049, oft noch herzlich in den gemeinsamen Lernbegleiter*innen- und Lerner*innenräumen bei einem selbstgezüchteten Kombucha. Fächer gibt es schon lange nicht mehr, ebenso wenig wie zeitlich durch eine Klingel begrenzte Stunden und Noten, um das Wirken der Kinder zu bewerten. Schulangst ist aus dem Duden gestrichen und die Bewerbung um den beliebten und gesellschaftlich geachteten Lehrberuf ist langwierig und komplex. Nur noch die Besten werden mit der Ausbildung der Menschen der Zukunft betraut und für ihren Einsatz entsprechend bezahlt. Dass Bildung einst vererbt wurde, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wir leben in einem Land, wir arbeiten in einer Stadt, die sinnvoll in Bildung investiert und entsprechende Ergebnisse dafür erhält.
Wagen Sie einen Blick in die Kristallkugel
Gleich neben dem Lernbüro meiner Kollegin sitze ich mit sieben Schüler*innen um einen Tisch. Ayse hat heute ein Zeugnis ihrer Großmutter mitgebracht. Weil Ayse lieber in ihrer Erstsprache türkisch kommuniziert, ist eine Kollegin an ihrer Seite, die bei Bedarf übersetzt. Eigentlich würden wir die Kollegin gar nicht brauchen, weil alle Schüler*innen und ich zurzeit gemeinsam Türkisch lernen. Aber, sie geht lieber auf Nummer sicher.
Das Zeitdokument Zeugnis liegt vor uns. „Damals gab es noch Noten“, erzählt Ayse. „Noten? So wie in Musik?“, fragt Ella erstaunt. „Haben die dann das Zeugnis ihren Eltern vorgesungen?“, kichert Mansur. „Was wurde dann benotet? Und wie soll das gehen?“, staunt auch Elvetiano. Die Augen meiner Schüler*innen werden immer größer. „Meine Oma hat erzählt, dass sie meistens dann gute Noten bekommen hat, wenn sie still auf ihrem Platz gesessen ist, und schön geschrieben hat. Und dass sie, nachdem sie gelernt hat, immer alles gleich vergessen hat. Und dass vieles, was sie lernen musste, gar nichts mit ihrer Welt zu tun hatte.“ Ayse ist in ihrem Element. Sie ist sprachlich extrem begabt, und liebt es, wenn sie vor allen reden kann. Elena lacht mich an und sagt: „Würdest du mir also eine Eins geben, wenn ich das nächste Mal nichts verstanden habe, aber dafür mit meiner schönsten Schrift brilliere?“ Kluges Mädchen, denke ich mir. Sie ist graphisch eine der Besten. Mansur hat lange nichts gesagt, aber jetzt bringt er sich in die Diskussion ein. „Wozu oder warum gab es die Noten überhaupt?“ Ich versichere mich zuerst, ob nicht ein*e Schüler*in darauf antworten will. Das gehört auch zum Lernkonzept 2050. Expert*innen sind nicht wie selbstverständlich die Lehrer*innen, Vorrang haben die Schüler*innen. Nachdem keiner antworten möchte, erkläre ich den Begriff Leistungsgesellschaft. Diese hat längst ausgedient, zum Glück. Und als ich sage, dass in dieser Gesellschaftsform die Ansicht vorherrschte, dass es jede*r, der oder die wollte es schaffen würde, ein tolles Leben zu führen, unterbricht mich Mansur entrüstet. „Blödsinn. Das kann gar nicht gehen. Meine Großeltern haben immer gearbeitet, aber als sie dann in Pension gingen, waren sie arm. Sie hatten auch kein Geld, um zum Beispiel meinem Vater Nachhilfe zu bezahlen. Nachhilfe war so , dass du nach der Schule noch Privatunterricht bekommen hast. Weil die Schule es nicht geschafft hat, dir etwas beizubringen.“
„Aber, gab es in diesen Zeiten keine Lehrer*innen, die Noten und Leistungsgesellschaft kritisch betrachtet haben?“ „Und das haben sich alle gefallen lassen?“ „Und, war es wirklich so, dass viele Schüler*innen Angst hatten in die Schule zu gehen?“ Ich sehe, diese Einheit wird heute länger dauern. Immer mehr Fragen kommen auf. Viele, die ich nicht so leicht beantworten kann. Auch ich brauche eine Expertin oder einen Experten. Zum Glück sind Schulen im Jahr 2050 perfekt vernetzt. Eine Historikerin und Wirtschaftsfachfrau steht uns in einem Videochat Rede und Antwort. Nach drei Stunden, natürlich mit Pausen, verlassen die Schüler*innen das Lernbüro, nur Ella bleibt zurück. „Sag, wann hat dieses Umdenken eigentlich stattgefunden?“, will sie wissen. „Das war ein paar Jahre nach der Corona-Krise.“ „War das diese Pandemie? Können wir morgen darüber reden?“, fragt sie mich. „Gerne. Ich glaube meine Großmutter hat in der Zeit sehr viel darüber geschrieben“, antworte ich.
Zurück zur Realität
Willkommen zurück im Jahr 2021. Die vergangenen 17 Monate haben uns alle viel Kraft gekostet. Aber sie haben uns deutlich wie nie zuvor die Mängel eines veralteten Bildungssystems aufgezeigt. Jetzt ist die Chance verkrustete Strukturen aufzubrechen, um diese Utopie wahr werden zu lassen. Fangen wir damit am besten morgen schon an.
Maria Lodjn, Franziska Haberler und Jonathan Herkommer sind Lehrer*innen in Wien und im Redaktionsteam von Schulgschichtn.