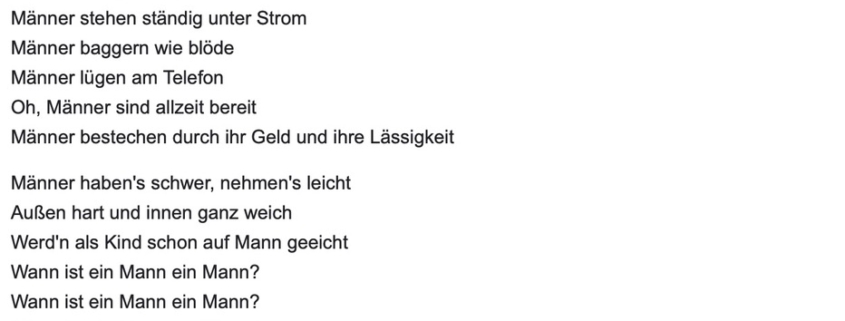“Einmal Lehrer*in – immer Lehrer*in.” Das gilt für die überwiegende Mehrheit der Personen, die sich für das Lehramt entscheiden heute noch immer. Während der Quereinstieg in den Lehrberuf zunehmend erleichtert wird, ist ein – wenn auch nur zeitlich begrenzter – Ausstieg oder eine berufliche Umorientierung in der Regel nur schwer möglich.
Wir haben mit vier Lehrerinnen gesprochen, die sich über die Initiative Seitenwechsel für einen solchen temporären Umstieg entschieden haben. Für ein Jahr arbeiten sie in Unternehmen um schließlich mit neuen Perspektiven und Skills zurück in die Schule zu kommen:
Warum hast du dich dafür entschieden für ein Jahr die Schule zu verlassen und in einem Betrieb zu arbeiten?
Cornelia: Ich bin über Umwege Lehrerin geworden, habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Nach ein paar Unterrichtsjahren war mir nach Abwechslung, neuem Input. Ich habe bereits Arbeitserfahrung mitgebracht, und wollte meinen, für mich auch im Unterricht extrem wertvollen, Background noch erweitern.
Anna*: Weil ich bisher kaum Berufserfahrung außerhalb des Bildungsbereichs hatte und hier die Chance gesehen habe, den Alltag in einem Betrieb kennenzulernen und mein Fachwissen auch einmal praktisch anwenden zu können.
Mitra: Ich war jetzt 4 Jahre Klassenvorständin und habe meinen Schwerpunkt stark auf Berufsorientierung gelegt, da dieses Thema unsere Jugendlichen in der Mittelschule sehr stark betrifft und vor allem auch beschäftigt. Es ist wahnsinnig schwer, sich mit 14 zu entscheiden, was man als nächstes machen möchte, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich bin froh, dass ich das damals nicht musste.
Ebenso lege ich einen großen Schwerpunkt auf sogenannte „Life skills“, also Umgang mit Geld, wie ein Haushaltsbuch führen, Eingaben und Ausgaben, wie viel und welche Ausgaben kommen überhaupt auf mich zu, wenn ich alleine wohne, wie vergleiche ich Versicherungen, suche ein Bankkonto aus, wie funktionieren Kredite, Schulden usw.
Wenn diese Themen nicht durch die Eltern erlernt werden, bleibt nur die Schule. Deshalb ist es wichtig, dass wir Lehrer*innen auch viele solcher Kompetenzen lehren.
Um meine Schüler*innen nun so gut und vor allem so authentisch wie möglich auf die Berufswelt vorzubereiten, wollte ich selbst die Arbeitswelt außerhalb der Schule kennenlernen.
Durch Seitenwechsel hatte ich zum Glück die Gelegenheit dazu und habe es gewagt.
Ja, es ist ein großer Schritt, weg vom gewohnten Arbeitsumfeld zu gehen und etwas zu machen, wo man sich nicht wirklich auskennt, obwohl man eigentlich immer diejenige ist, die das tut. Aber genau das, ist doch auch wieder wichtig, um sich besser in die Lage unserer Jugendlichen hineinzuversetzen.
Alexandra: Eine langjährige Kollegin hat mir einen Zeitungsartikel über die Initiative Seitenwechsel übermittelt und somit begann ich mich über dieses Projekt zu informieren. Nach jahrelanger Unterrichtstätigkeit ermöglicht mir dieses Programm meine fachlichen Kompetenzen zu erweitern und mich persönlich weiterzuentwickeln.
Wie bist du im Unternehmen aufgenommen worden?
Cornelia: Sehr offen! Was mich als Person, meine Stärken und Schwächen und die Themen an denen ich arbeite, betrifft.
Anna: Sehr gut. Gleich am ersten Tag wurde ich allen persönlich vorgestellt und die Kolleg*innen sind alle nett und hilfsbereit.
Alexandra: Am ersten Tag wurde ich vom Leiter der Personalabteilung in Empfang genommen und erhielt zuerst eine Gebäudeführung. Anschließend lernte ich meine KollegInnen im Labor kennen. In der ersten Arbeitswoche hatte ich ein Onboarding-Programm, indem die Abteilungsleiter*innen für administrativen Angelegenheiten ihre Aufgabenbereiche vorstellten. Daher wusste ich bereits, wen ich bei Fragen kontaktieren kann. Die Hilfsbereitschaft meiner KollegInnen ist sehr wertvoll für meine „neue“ Tätigkeit.
Was sind deine neuen Aufgaben? Fühlst du dich mittlerweile gut eingearbeitet?
Cornelia: Aufgaben gibt es in unserer Abteilung viele; viele Ideen, die umgesetzt werden wollen. Unter all den Technikern (und einer Technikerin) habe ich mir anfangs nicht viel zugetraut. Mittlerweile ist es besser, ich habe das Gefühl, die Aufgaben einschätzen zu können und weiß besser, was ich mir zutrauen kann.
Anna: Auch wenn ich mittlerweile eingearbeitet bin, gibt es immer wieder neue Herausforderungen und ich lerne ständig dazu. Es macht aber immer wieder Freude und stärkt mein Selbstbewusstsein, wenn ich wieder etwas geschafft habe.
Mitra: Am Anfang habe ich doch eine Weile gebraucht und es war manchmal nicht so angenehm, nicht die zu sein, die sich auskennt, sondern die, die Erklärungen und Arbeitsanweisungen braucht.
Trotzdem und vor allem auch durch das hilfsbereite und nette Team, konnte ich mich gut einfinden und arbeite mittlerweile schon gut mit. Und vor allem schon etwas selbstständiger.
Mein Hauptbereich ist das Risikomanagement, wo ich Berichte überarbeite und erneuere, von Berichten Powerpoint Präsentationen als Zusammenfassung und Übersichten erstelle. Ebenso erstelle ich neue Beurteilungsblätter für Einzelrisiken.
Nebenbei unterstütze ich unsere Juristin bei Recherchen, Korrekturlesen von juristischen Texten oder Erstellen von Powerpoint Präsentationen und lese auch zukünftige Artikel oder Broschüren für die PR Managerin gegen.
Ich werde in dem Jahr aber auch noch die Arbeit der anderen Bereiche der B&C kennenlernen, wie zum Beispiel die Innovation Investment oder die Stiftungsarbeiten. Bei beiden darf ich jetzt schon immer wieder ein bisschen reinschnuppern.
Alexandra: Auf jeden Fall war es zu Beginn eine große Herausforderung in einem Labor tätig zu sein und neue wissenschaftliche Methoden kennenzulernen. Es ist eine vielseitige Tätigkeit in internationalem Umfeld, daher wird Englisch als Arbeitssprache verwendet. Die Abläufe meiner Arbeit sind gut strukturiert und meine Labortätigkeit muss täglich dokumentiert werden. Inzwischen kann ich zum Teil selbstständig im Labor arbeiten und darüber freue ich mich.
Wo liegen die auffälligsten Unterschiede zwischen dem schulischen und deinem jetzigen Arbeitsumfeld?
Cornelia: Die Lautstärke; der Stress, dem man als Lehrer*in oft ausgesetzt ist. Besonders in der Zeit von Covid. Mehr Sachlichkeit, weniger Zwischenmenschliches.
Anna: Das Markanteste ist, dass ich meine Arbeitsmaterialien vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt bekomme und ich zwar keine Ferien habe, aber dafür jeden Abend und jedes Wochenende frei habe. Auch erhalte ich für jede Stunde, die ich zusätzlich arbeite, Zeitausgleich. Außerdem ist die Hierarchie steiler, ein*e Vorgesetzte*r hat weniger Leute zu betreuen wie ein*e Direktor*in. Dadurch ist er*sie aber auch leichter zu erreichen.
Alexandra: Ein besser ausgestattetes Arbeitsumfeld für MitarbeiterInnen, IT-Abteilung (Wartung der Laptops sowie PCs, Installation der Software, Unterstützung bei IT-Problemen etc.), definierte Aufgabenbereiche, wöchentliche Besprechungstermine, Organisation der Dienstreisen durch Backoffice und vieles mehr-
Was denkst du, welche neuen Kompetenzen oder Blickwinkel wirst du nach diesem Jahr mit zurück in die Schule bringen? Wie werden davon die Kinder und/oder der Schulstandort profitieren?
Cornelia: Mit so einer Erfahrung wächst man als Persönlichkeit. Deshalb ist das, was ich mitnehme sehr vielfältig. Von bestimmten Planungstools, Fachwissen, zwischenmenschlichen Erlebnissen, Gelassenheit, verstärkt den Blickwinkel der Eltern einbeziehen, Ideen für Veränderungen in der Organisation… Das alles sind spannende Themen für den Unterricht.
Anna: Die Schüler*innen werden dadurch profitieren, dass ich die Frage nach der praktischen Anwendung von Mathematik nicht nur aus zweiter Hand beantworten kann, sondern ich auch ganz konkret von meinen Erfahrungen berichten kann. Durch die Kontakte, die ich geknüpft habe, ist es auch sicher einfacher Betriebsführungen zu organisieren.
Mitra: Ich denke, allein den Mut zu haben, bei dem Projekt mitzumachen, ist schon mal eine wertvolle Kompetenz, die wichtig für Schüler*innen ist. Seine Komfortzone zu verlassen, ist für niemanden leicht. Jugendliche müssen das ständig tun, sich das in Erinnerung zu rufen, stärkt das Verständnis in so manchen Situationen.
Nicht immer die Lehrende, sondern wieder einmal in „Schüler*innenposition“ zu sein, ist sehr lehrreich und oft nicht angenehm. Ich bin zwar wirklich geduldig, aber sich in Erinnerung zu rufen, dass man manche Dinge einfach auch mal nicht versteht und dass da jetzt niemand Schuld ist, sondern einfach manchmal länger braucht, ist sehr hilfreich, bei unserem Job.
Natürlich ist jede Firma und jede Arbeit anders, aber in einem, „klassischen“ 40 Stundenjob hat man natürlich weniger Freiheiten in der Arbeits-und Zeiteinteilung. Das ist definitiv eine Umstellung. Einerseits ist es angenehm, da jetzt für ein Jahr Wochendende wirklich Wochenende ist, was es im Lehrer*innenalltag meistens nicht ist. Andererseits war 9-10 Stunden im Büro am PC zu arbeiten, definitiv eine große Umstellung für mich.
Genau vor dieser kompletten Umstellung stehen aber unsere Schüler*innen nach der Mittelschule, wenn sie entweder eine Lehre machen oder in eine weiterführenden Schule wechseln, wo das Stunden-und Lernpensum definitiv höher ist, als bei uns.
Ganz wichtig für mich hierbei ist es natürlich, dass ich meinen Schüler*innen aus meinen eigenen Erfahrungen berichten kann: Wo kann es Schwierigkeiten geben? Was sind wichtige Fähigkeiten, die man vielleicht brauchen könnte? Wie schaffe ich es, mich einer neuen SItuation zu stellen, den neuen Alltag mit meinen Hobbies zu vereinbaren? usw.
Aber durch die Arbeit in der B&C erhalte ich auch spezielles Fachwissen. Durch die Stiftung und ihre Arbeit lerne ich viele Bildungseinrichtungen und Initiativen kennen, die ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten möchte und auch versuche, mit der Schule zu verbinden. Gerade im Bereich „Wirtschaftsbildung“ gibt es viele Initiativen und das brauchen wir.
Nach dem einen Jahr, weiß ich auf jeden Fall auch wieder ganz genau, ob ich den richtigen Job gewählt habe. Ich denke, sich die Verantwortung und Schönheit unseres Berufes vor Augen zu halten, ist ganz wichtig.
Alexandra: Meine fachlichen Kenntnisse werden erweitert und dadurch auch meine Fähigkeit aktuelles Wissen in meinen Unterrichtsgegenständen zu vermitteln. Diese neuen Impulse kann ich in meiner Unterrichtstätigkeit zukünftig integrieren. Diese Initiative kann mir eine Kooperation mit diesem Unternehmen ermöglichen, sodass meine Schüler*innen eine Perspektive außerhalb der Schule erhalten und eventuell einen zukünftigen Arbeitsbereich kennenlernen.
Warum sollten auch andere Lehrerinnen und Lehrer diese Erfahrungen außerhalb des Klassenzimmers sammeln?
Anna: Weil es gut tut, eingefahrene Wege zu verlassen und auch einmal Neues kennenzulernen.
Mitra: Viele Lehrer*innen kommen nach dem Studium direkt in die Schule zurück und haben oft keine bis wenig wirkliche Arbeitserfahrung außerhalb der Schule. Aus diesem Grund finde ich es ganz essentiell, dass man diese Chance nutzt, um Einblicke in den Arbeitsalltag abseits der Schule zu bekommen und am eigenen Leib zu spüren, wie es ist in einer Firma zu arbeiten. In Folge kann man so natürlich dann auch die Schüler*innen viel besser und authentischer auf das Arbeitsleben vorbereiten.
Alexandra: Mit diesem Projekt können Lehrer*nnen neue Impulse für ihre Unterrichtstätigkeit erhalten und ihre Offenheit für Veränderungen bewahren.
Cornelia hat Genetik und Mikrobiologie studiert, ist AHS Lehrerin (Chemie, Biologie,Ökologie) und arbeitet seit September bei der Berndorf Band GmbH in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung als Chemikerin.
Anna*, ebenfalls AHS Lehrerin (Mathematik und Chemie), arbeitet aktuell in der R&D-Abteilung (Forschung und Entwicklung) eines Industriebetriebs.
Mitra hat ihre Lehrtätigkeit in einer Wiener Mittelschule dieses Jahr für eine Stelle bei der B&C Industrieholding getauscht und arbeitet dort in im Risikomanagement.
Alexandra unterrichtete im Gymnasium verschiedene naturwissenschaftliche Fächer und ist nun am Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy Sciences (CeMM) als Projektmitarbeiterin tätig. Dort liegt ihr Fokus im Erlernen von Zellkulturtechniken im biomedizinischen Forschungsbereich sowie der Anwendung der molekularbiologischen CRISPR/Cas-Methode.
Die Autoren sind Teilnehmer*innen des Seitenwechsel-Programms.
Kontakt über erwin.greiner@seitenwechsel.at
*Name von der Redaktion geändert