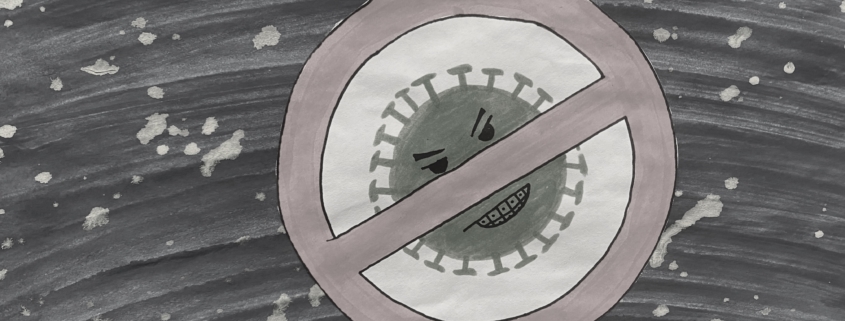Inge Eidsvåg begann einen mitreißenden Vortrag während eines Seminars in Norwegen mit einer Frage und der simplen Antwort:
„Was ist ein:e gute:r Lehrer:in? Das ist kurz gesagt sehr einfach: Ein:e gute:r Lehrer:in liebt Kinder und sein:ihr Fach.“
Ich würde sagen:
„Ein:e gute:r Mittelschullehrer:in liebt Kinder und sein:ihr Fach.
„Ein:e gute:r AHS Lehrer:in liebt ihr:sein Fach und Kinder.“
Ich selbst wollte schon als kleines Kind Lehrerin werden und habe nach der Matura für das Lehramt an der Uni studiert. Die Fächer, die ich unterrichten wollte bzw. auch jahrelang unterrichtet habe, waren für mich zweitrangig. Ich wollte junge Menschen „unterrichten“, sie am Weg ins Erwachsenwerden begleiten. Die Fächer waren für mich eher „Mittel zum Zweck“.
Während ich viele Jahre später für den Stadtschulrat (heute Bildungsdirektion Wien) und das Bildungsministerium unterschiedlichste Projekte betreute und leitete, hatte ich die Möglichkeit, unzählige Schulen, und ab und an auch den Unterrichtsstunden, von der Volksschule bis zu BHS zu besuchen.
Damals wurde mir klar: Ich hätte Mittelschullehrerin werden sollen, denn dort wird anders unterrichtet und Lehrer:innen haben auch die Möglichkeit dazu.
Was will ich damit sagen:
Im Gymnasium ist man als Lehrer:in extrem gefordert, um die Schüler:innen der Oberstufe zu Matura zu bringen. Umfangreiches Fachwissen, das man ständig aktualisieren und sich aneignen muss, lässt oft wenig Zeit sich mit pädagogischen bzw. didaktischen Themen auseinander zu setzen. Schüler:innen die z.T. noch voll in der Pubertät stecken zum Lernen zu motivieren, ist nicht immer einfach; nicht unbedingt leichter als bei den „Kleinen“ der Unterstufe, aber anders.
Für die „Kleinen“ bleibt dann meistens wenig Zeit und Energie übrig. Das muss nebenbei funktionieren. Und der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung mit den Schüler:innen ist, vor allem wenn man nur ein Zwei-Stunden Fach hat und nicht Klassenvorstand ist, schwer.
In der Mittelschule kann man sich als Lehrer:in voll und ganz auf die 10-14-Jährigen konzentrieren. Die Pädagogik steht im Vordergrund. Also das eigentliche „Lehrer:in-sein“, Kinder und junge Menschen auf den Weg ins Erwachsenwerden zu begleiten, ihre Stärken erkennen, ihr Selbstvertrauen stärken. Der Schwerpunkt liegt nicht am Vermitteln von Lehrinhalten.
In der Mittelschule kann man meines Erachtens „Mit Leib und Seele Lehrer:in sein“.
- Man unterrichtet mehrere Fächer. Manchmal auch solche, die man nicht studiert hat, was nicht unbedingt ein Nachteil ist, weil man als „Lernende:r“ ein großartiges Vorbild für die Schüler:innen ist. Man verbringt also mehr Zeit mit den Schülerinnen und Schülern, das bedeutet
- man lernt sie und ihre besonderen Stärken (jedes Kind hat solche!) besser kennen,
- man kann leichter Beziehung zu ihnen aufbauen, was grundlegend für ein positives Arbeitsklima ist,
- man kann mit der Zeit gut jonglieren, daher manchmal auch Stunden – die man sowieso selbst in der Klasse unterrichtet – umtauschen und kann deshalb
- geduldiger und einfühlsamer auf die einzelnen Schüler:innen und deren Bedürfnisse eingehen, kann ihr Selbstwertgefühl stärken,
- größere – auch fachübergreifende – Projekte durchführen
- didaktische „Ideen“ und Methoden ausprobieren, um mit „schwierigen“ oder besonders begabten Schüler:innen besser zurecht zu kommen,
- die sprachliche und kulturelle Vielfalt in unseren Mittelschulklassen als Bereicherung für alle Schüler:innen bzw. alle Lehrer:innen erkennen und pflegen.
- Sehr oft sind Mittelschulen geräumige, große, manchmal auch moderne Gebäude, in denen die Schüler:innen nicht zusammengedrängt in den Klassen sitzen, was bei AHS öfter der Fall ist. Die Klassenschüler:innenzahl ist meistens wesentlich geringer als an den AHS.
- Der Lehrkörper ist (meistens wesentlich) kleiner, man lernt also Kolleg:inn:en schneller kennen und auch der Austausch untereinander ist einfacher.
- Die Fortbildungsangebote für die Sekundarstufe 1 sind – nicht nur in Wien – sehr vielfältig
- und oft sind Mittelschulen technologisch besser ausgestattet als AHS (Mittelschulen sind Landesschulen, es kommt also aufs Bundesland an).
Drei kleine, meines Erachtens typische, Mittel- „Schulgschichtln“ möchte ich hier noch beschreiben, wie ich sie während meiner zahllosen Schulbesuche erlebt habe.
Schule 1:
Ich betrete das schon etwas ältere Schulgebäude, ich habe einen Termin beim Direktor. Es ist gerade Pause.
Schüler:innen bewegen sich mehr oder weniger ungestüm durch die Gänge, die Stiegen auf- und abwärts. Den meisten Kinder sehe bzw. „höre“ ich an, dass ihre Familien nicht aus Österreich stammen. Die Gesichter der Kinder sind heiter, jedes(!) grüßt mich höflich und freundlich, obwohl sie mich nicht kennen. Und auf die Frage, wo denn die Direktion sei, findet sich gleich ein kleines Grüppchen, das mich zum Direktor begleitet.
Ich mache dem Direktor gleich ein Kompliment zu seinen höflichen Schüler:inne:n.
„Ja, das ist das Erste, das wir ihnen beibringen: ein Lächeln, in die Augen schauen, jeden, der ins Schulhaus kommt, bzw. auch jeden Lehrer und jede Lehrerin, höflich grüßen.
Sie werden wahrgenommen, auch gegrüßt und angelächelt. Das steigert ihr Selbstwertgefühl. So fühlen sich alle hier wohl und auch wenn die Schüler:innen die Schule verlassen, nehmen sie dieses Benehmen – hoffentlich – mit.“
Die Lehrer:innen gehen übrigens mit gutem Vorbild voran, sind freundlich zu den Schüler:innen, respektvoll, hören ihnen zu. Im überfüllten Konferenzzimmer wird viel gelacht und gescherzt.
Eine großartige Atmosphäre in einer Schule, in der 95% (die Lehrer:innen sagen 110 % ;-) ) der Kinder mit anderen Erstsprachen und kulturellen Hintergründen in den Klassen sitzen.
Es gibt hier viele Probleme zu meistern, das ist klar. Aber mit einem Lächeln im Gesicht…
Schule 2:
Ich klopfe an der Klassentüre, ich werde erwartet. Ich öffne die Türe. Vor mir steht ein großer, knurrender Schäferhund. Die lächelnde Lehrerin bedeutet dem Hund, dass ich eintreten darf.
Der Hund legt sich vor dem Katheder nieder, hat alle Schüler:innen im Blick.
Kaum wird es unruhig in der Klasse, hebt er seinen Kopf, knurrt, blickt in die Runde. Alle Kinder sind wieder leise.
Sie lieben ihren Schulhund. Lupo*gehört einer Lehrerin, die ihn zu einem Schulhund ausbilden ließ. Besonders unruhige, unsichere, traumatisierte Kinder und solche mit Einschränkungen finden bei dem Tier Ruhe und Liebe.
Schule 3:
Chemiestunde. Der Chemielehrer zeigt Versuche, beschreibt was geschieht und bittet nun einen Schüler, noch einmal seinen Mitschüler:innen mit eigenen Worten zu erklären, worum es geht und was er gezeigt hat.
Goran* bemüht sich und erklärt in kurzen, unvollständigen Sätzen, was er verstanden hat. Der Lehrer bittet einen anderen Mitschüler, Goran zu unterstützen ganze zusammenhängende Sätze zu formulieren.
Noch hat der Lehrer nicht das Gefühl, dass alle Schüler:innen verstanden haben, worum es ging.
Er bittet eine Schülerin: „Ebru*, wenn du daheim der Mama erklären würdest, was wir da gemacht haben, was würdest du ihr erzählen? Das kann gern auf türkisch sein.“
Ebru versucht es auf türkisch, ihr fehlen aber Fachbegriffe. Mitschüler:innen unterstützen sie.
Dann noch einmal alles auf Deutsch.
Dass in dieser Klasse auch mehrsprachige Plakate aus dem Biologieunterricht hängen, beeindruckt mich.
Ich bewundere den Lehrer, wie viel Zeit er sich nimmt, bzw. den Schüler:innen gibt. Alles in Ruhe, kein Stress. Er ist erst zufrieden, wenn alle Kinder den Stoff dieser Stunde verstanden haben. Dazu opfert er auch die anschließende Mathematikstunde. Er unterrichtet in der Klasse auch Mathematik und Physik und… Jedenfalls kann er mit den Stunden jonglieren und er erklärt mir: „Wenn die Schüler:innen verstehen, worum es geht, bauen sie ein gutes Fundament auf, dass später viel Zeit erspart.“ Und augenzwinkernd: „Ich bin außerdem auch Sprachlehrer – wie wir alle.“
Ich könnte hier noch viele Schulen, Stunden, Lehrer:innen und Schüler:innen beschreiben, die mich immer wieder beeindruckt und überrascht haben.
Natürlich darf ich euch nicht vorenthalten, dass ich auch schockierende Situationen erlebt habe. Aber das ist ein anderes Thema. Nur so viel: Rechtzeitig die Schule wechseln und eigene Ideale nicht verkümmern lassen!
Schon vor 50 Jahren hat Don Milani über die Schulen in Italien gesagt:
Die Schule ist wie ein Krankenhaus, das die Gesunden heilt und Kranken hinauswirft.
Oft habe ich das Gefühl, dass es bei uns nicht viel anders ist. Wir Lehrer:innen können das ändern!
Zum Schluss möchte ich noch allen, die Lehrer:insein als Berufung sehen, folgendes Buch (kein belehrendes Sachbuch, als erfrischende Ferienlektüre unbedingt geeignet) ans Herz legen:
„Schulkummer“ von Daniel Pennac, (frz, Chagrin d’école (2007)
Und: in meinem nächsten Leben werde ich Mittelschullehrerin, oder vielleicht Volksschullehrerin?
Erika Hummer, ehemalige AHS Lehrerin, Mitarbeiterin der Bildungsdirektion und Mitbegründerin von VoXmi
1 Inge Eidsvåg ist ehem. Direktor der „Nansen Academy – the Norwegian Humanistic Academy” – https://nansenskolen.no
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pennac
*Namen geändert