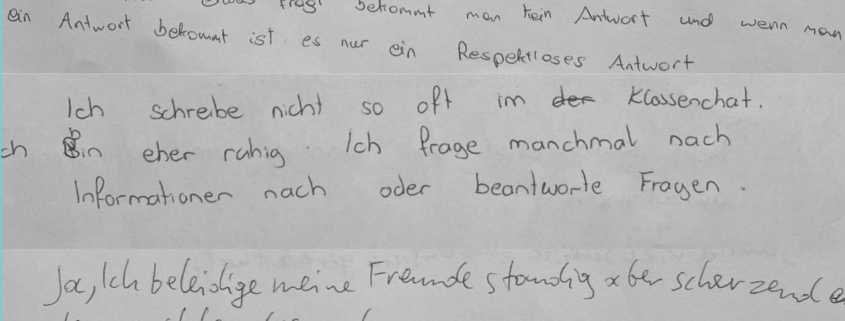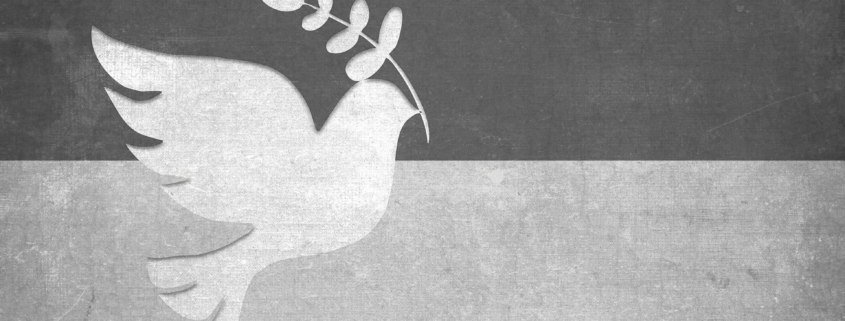Dr. Patrick Frottier, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie:
„Hass gab es immer schon, etwa als Reaktion auf unbewältigte Kränkungen, als Folge eines Selbstwertproblems, eines bewussten oder unbewussten Gefühls innerer Unsicherheit. Die Projektion dieses Minderwertigkeitgefühls auf eine Person, auf eine Personengruppe, auf alle anderen außer sich selbst oder gar unter Einbeziehung seiner eigenen Person ist demnach nicht neu. Neu ist jedoch die Geschwindigkeit der Verbreitung, die mögliche Unbegrenztheit der Reichweite, die Perfektionierung der Anonymität des verursachenden Auslösers. Das Neue liegt also in den Möglichkeiten, die der digitale Raum dem Hassenden bietet und nicht der Hass an sich.“
Wir sprechen über Klassenchats. Shitstorms, Hass im Netz – oft wird man „versehentlich“ Opfer. Klassenchats sind allgegenwärtig. Die berühmten „WhatsApp“ Gruppen, wohlgemerkt oft von Lehrpersonen selbst initiiert – „so Kinder, dann könnt ihr euch gegenseitig die Hausaufgabenafträge senden, das Organisatorische besprechen und euch gegenseitig an Referatstermine erinnern.“ Das ist die oft naive Vorstellung der Inhalte eines Klassenchats. Manchmal sind die Lehrpersonen dabei, oft nicht. Legal wäre das nicht, aber das ist die Nutzung von WhatsApp für Kinder unter 14 auch nicht. Und schon im 1. Lockdown 2020 wurde WhatsApp als zwar nicht gewünschte, dennoch aber (von der Bildungsdirektion) geduldeter Einstieg ins Distance-Learning schweigend toleriert.
Als Lehrperson bekommt man oft wenig mit von den wahren Ausmaßen des „Bashings“, welches an Stelle der Referatserinnerungen innerhalb der Klassenchats kursiert. Die mildeste Variante ist noch das Spammen, das Versenden von mehreren hundert Nachrichten ohne Inhalt. Es steigert sich oftmals bis hin zu einer wahren Hexenjagd, Bloßstellungen, Beschimpfungen, Beleidigungen. Bei einem Kind kursierten gefakte Pornobilder unbeliebter Lehrerinnen, bei einem anderen wünschte jemandes Mutter einen unfreiwilligen Geschlechtsverkehr mit einem überdimensionales Geschlechtsteil eines nicht österreichischen Mannes, an dessen Folgen sie bitte verenden möge. Ohne das „Bitte.“
Schulen sind machtlos. Die Inhalte zu kurzlebig, zu schnell wieder gelöscht. Doch sind sie das wirklich? Nichts was einmal im Netz war verschwindet für immer…
„Es ergibt sich eine Dynamik von digital versendeten Hassnachrichten, die im sozialen Netzwerken weder bezüglich der Verbreitung noch bezüglich der Reaktion irgendeiner Steuerung unterliegt. Der sich daraus ergebende emotionale Kontrollverlust berührt alle Beteiligte in schwer vorhersehbarer Weise, die möglichen wirksamen Variablen übersteigen bisher alle gültigen Prognose- und Gegensteuerungsmaßnahmen. Dieser Kotrollunmöglichkeit ist für den Nachrichtensender Anreiz sein Gefühl auszuleben und Vermeidung einer diesbezüglichen Konsequenz zugleich. Er setzt mittels weniger gedrückter Tasten einen minimalen Impuls mit einer unvorhersehbar großen Konsequenz, ganz der Symbolik seines Minderwertigkeitsgefühls entsprechend: aus ganz klein wird ganz groß.“
Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Was können wir tun? SaferInternet Workshops werden besucht, Schilfs zu diesen Themen wachsen aus dem Boden.
„Die Sehnsucht nach allgemein gültigen Tipps im pädagogischen Bereich entsprechen meist der eher naiven Sehnsucht, jedes Problem hätte auch eine zugehörige Lösung. Jede Eingrenzung des Benützens von sozialen Netzwerken führt regelhaft zu Widerstand, sei aus einer demokratischen oder trotzigen Reaktion heraus. Da jedoch Hass als Mischgefühl des Neides, des Zorns und der inneren Angst seit Bestehen der Menschheit, also in unserer Kultur seit Kain und Abel, gegenwärtig ist, wäre die offene Diskussion über die ganze Palette der Gefühle, ihrer Ursachen und der Umgang mit ihnen, auch als Unterrichtsstoff, welcher unabhängig von inadäquatem und dysfunktionalen Umgang mit digitalen Medien gelehrt werden sollte, sinnvoller als eine Begrenzung neuer Medien.“
Aber irgendwas müssen wir doch tun!?
„Mit Schülern und Schülerinnen eine Diskussion über enttäuschte Erwartungen und dem sich daraus entwickelnden unberechtigten Anspruchsdenken, welche in Hass münden können, zu führen – also einen wiederholten Diskurs über des Menschen offensichtliche eingeschränkte Fähigkeit unabweisliche und tägliche Kränkungen des Lebens zu tolerieren, zu jedem sich ergebenden Anlass anzuregen – das wäre eine pädagogische Aufgabe, die zwar niemals ein Ende nehmen, sich aber zweifellos lohnen würde. Und jeder könnte sich fragen: wen habe ich zu welchem Anlass schon einmal gehasst, wie habe ich meinen Hass ausgelebt, wann bin ich schon gehasst worden und wie habe ich mich dabei gefühlt. Die Gemeinsamkeit der Erfahrung könnte die dem Hass zugrundeliegende Trennung zumindest bewusst machen, das wäre ein erster Schritt hin zur Solidarität welche eine Klasse erst zu einer solchen macht, welche erst dann dem Wort „Klassengemeinschaft“ eine Berechtigung gibt.“
Erfahrung einer Lehrerin (BHS)
Letztes Jahr wurden mir durch Erziehungsberechtigte Klassenchats weitergeleitet, die hinter der Grenze der Legalität waren. Ich hatte das Glück, dass ich mich gleich an mehrere Fachexperten wenden konnte: einerseits an die Direktion, wo ich viel Unterstützung bekommen habe, andererseits an einen in Mediation, Mobbing- und Gewaltprävention sehr erfahrenen Kollegen und Coach, und auch an einen Freund, der in einer staatlichen Organisation arbeitet und Erfahrungen mit diesen Themen gehabt hat.
Die Intervention seitens der Direktion ging in mehrere Richtungen. Einerseits wurden Gespräche mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern im Beisein ihrer Eltern geführt, die dazu geführt haben, dass mehrere Personen die Klasse bzw. die Schule verlassen haben. Andererseits wurden diese Personen an die Behörden gemeldet und die Fälle von den zuständigen staatlichen Stellen weiterbearbeitet.
Mit der Klasse wurde unmittelbar danach ein ganztägiger Workshop gemacht, in dem über das Gewicht des Geschehenen aufgeklärt wurde, über die gesetzliche Lage in Österreich sowie über die geschichtlichen Zusammenhänge und Hintergründe für diese Gesetze. Und es wurden danach mehrere Chancen genutzt, gruppendynamische Übungen zu machen. Dies war gut, denn die Situation am Anfang war schwierig, es herrschte Fassungslosigkeit, denn „das war ja nur Spaß“. Nach dem Workshop konnten die Schülerinnen und Schüler die Situation einordnen, auch wenn nicht alle mit den Konsequenzen für ihre MitschülerInnen einverstanden waren. Das Klassenklima hat sich aber sukzessive gebessert.
Für mich selbst waren diese 2 Wochen unheimlich schwierig, ich hatte aber viel Unterstützung im Kollegium und von der Schulleitung. Was es in der Prävention braucht? Aufklärung, echte Geschichten und Fälle, und vor Allem Sensibilisierung der SchülerInnen dafür, dass „Spaß“ kein Freibrief für ist.
Und was sagen die Schüler:innen?
Um die Sicht auf Klassenchats von den Schüler:innen zu erhalten, haben wir uns entschieden, sie anonym und schriftlich Fragen beantworten zu lassen. Dadurch hofften wir auf möglichst ehrliche und wahrheitsgetreue Antworten. Im Großen und Ganzen blieben die Antworten dennoch vage. Ein vertiefendes Gespräch wäre sicher noch aufschlussreicher, um hier auch einzelne Rollen der Schüler:innen in den Chats herausfiltern und analysieren sowie mit ihnen reflektieren zu können, wie und warum sie in dem Moment gehasst haben.
Wenig überraschend sehen die Schüler:innen den Klassenchats als einen wichtigen Austauschkanal an, um vor allem schulische Fragen zu klären. Viele befürworten eine Klassengruppe zum Austausch über Verpasstes, ausgefallene Stunden oder Unterstützung bei der Hausübung. Interessant bei letzterem ist, dass hier besonders fertige HÜs angefragt werden, dass in einer Klasse bei einigen für Unmut sorgen dürfte.
Unerwünscht sind Personen, die den Chat zum Spamm
en verwenden; die also tagtäglich unaufgefordert Sticker, Videos und Memes teilen. Bei Mitschüler:innen, die beleidigen, Gerüchte verbreiten, jemanden absichtlich verletzen und schlecht über andere schreiben, durchzog sich der Tenor des Blockieren-Wollens laut und deutlich. Weil zum „Scheiße schreiben“, sei der Chat nun mal nicht da. Ebenso beschwerten sich einige, dass manche viel zu viel „Unnötiges“ in den Chats schrieben, private Konflikte hintrügen und sie als Bühne nützten bzw. andere heruntermachten, wenn nicht geantwortet würde.
Interessant waren auch die verschiedenen Antworten hinsichtlich der Reflexion der eigenen Rolle im Chat. Viele nehmen sich als helfend wahr. Andere beobachten lieber, um am Laufenden zu bleiben. So manch eineR hat den Chat bereits wieder verlassen und fragt lieber privat nach. Stumm gestellt ist er bei den meisten. Spannend ist hier die Veränderung zu Unterstufe.
Die deutliche Mehrheit meinte, in der Unterstufe sei es lustiger zugegangen und sie hätten sich produktiver ausgetauscht; auch weil sie sich schon besser gekannt hätten. Viele führten die fehlende Klassengemeinschaft als Grund für die oftmals schlechte Stimmung in den Chats an. Das traf besonders auf die Befragten in ersten Jahrgängen zu.
Zum Ende lassen sich zwei Umgangsmöglichkeiten mit dem Klassenchat aus den Antworten der Schüler:innen herauslesen:
1) Sie ziehen sich zurück; das kann heißen, sie werden zu Leser:innen und vermeiden das aktive Schreiben, Antworten und Interagieren oder sie verlassen den Chat ganz und kontaktieren einzelne Mitschüler:innen oder gründen kleinere Privatgruppen.
2) Sie befürworten den Chat weiterhin, weil für sie die positiven Eigenschaften des Austausches, des Dazugehörens und der Hilfemöglichkeiten überwiegen.